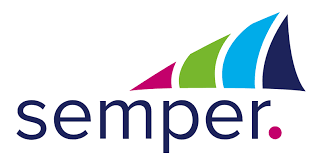Christian Arbeit, Geschäftsführer Kommunikation und Pressesprecher des 1. FC Union Berlin e.V., ist ein wichtiger Impulsgeber für Ostdeutschland. Er setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist er auch in dem Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.

Christian Arbeit, Geschäftsführer Kommunikation und Pressesprecher des 1. FC Union Berlin e.V. Abbildung: Nadia Saini/AFTV
OST. Da sind sie also wieder, die drei Buchstaben, die es mit schöner Regelmäßigkeit schaffen, unser Land in Aufregung zu versetzen. Bis vor wenigen Jahren prangten sie stolz und selbstbewusst über der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in der Mitte Berlins. Sie sind weg und das einst große Theater ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Nun stehen sie auf dem Deckel dieses Buches und fordern heraus – zum Lesen, zum Nachdenken und zur Fortsetzung einer immer wieder aufflammenden Auseinandersetzung.
Wie schaffen sie das nur, diese drei Buchstaben? Was daran ist so speziell, dass sich Deutschland regelmäßig darüber in die Haare kriegt? Vielleicht hat es mit dem Wunsch, gewinnen zu wollen, zu tun; ganz sicher aber mit dem Anspruch auf Deutungshoheit auf der einen Seite und einem unwiederbringlichen Verlust auf der
anderen.
Eine glückliche Kindheit
Ich wurde im Februar 1974 in Ostberlin geboren und gehöre zu den Menschen, die heute noch mit großer Selbstverständlichkeit sagen, dass sie eine glückliche Kindheit in der DDR hatten. Meine Eltern waren beide voll berufstätig, ich war gern im Kindergarten, habe mich auf die Schule gefreut und bis heute den Eindruck, von Eltern, Erziehern und Lehrern sehr gut auf die Komplexität des Lebens vorbereitet worden zu sein. Stolzer Jung- und später Thälmann-Pionier sowie alsbald gelangweilter FDJler war ich auch, und ich habe mich trotzdem in der Christenlehre und der Jungen Gemeinde der Kirche um die Ecke wohlgefühlt. Nichts davon stand dem anderen im Wege.
Das Gefühl, behütet aufgewachsen zu sein, ist vielleicht der Kern meiner Kindheitserfahrung. Existenzielle Sorgen um Arbeitsplatz, Wohnung oder gar Essen und Trinken gab es nicht, Zukunftsängste auch nicht. Abends saß die ganze Familie zum Abendbrot am Tisch und wir hatten Zeit, über die Themen des Tages zu sprechen, kleinere und größere Sorgen zu diskutieren oder zusammen zu lachen. Das Wochenende war frei (für die Eltern – nicht für uns Schulkinder), Familienurlaube und Betriebsferienlager führten uns an die Ostsee oder in den Thüringer Wald. In besonders exotischen Ausnahmefällen aber auch mal in die Tschechoslowakei, die – im Gegensatz zu Deutschland – damals ein gemeinsames Land war und es heute nicht mehr ist.
War die DDR also doch das ersehnte „Arbeiter- und Bauernparadies“? Eine schöne, kleine „heile Welt“? Natürlich nicht. Und kaum jemand hat das ernsthaft behauptet. Aber was fehlte denn eigentlich? In meiner Erinnerung ist das leicht zu beschreiben: immer irgendetwas, aber eben nichts Lebensnotwendiges. Mal Zahnbürsten, mal Kirschen, mal Turnschuhe, mal Kleiderschränke und für die Großen vor allem Autos. Schade, aber so wichtig nun auch nicht – wenn man nicht ständig in das prallgefüllte Schaufenster der Bundesrepublik geschaut hätte. Tja, das Wecken von Bedürfnissen ist schon eine interessante Kunst und – das war mir damals noch nicht klar – ein cleveres Mittel, Politik zu machen, ist es auch.
Eine elementare Erfahrung OST: Nichts ist für immer.”
Aber was noch? Das kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Nein, sicher nicht. Das große Wort „Freiheit“, das den Zerfall der DDR später machtvoll begleitete, war eben nicht nur ein Wort. Ich selber war zu jung für die dramatische Erfahrung tatsächlicher Unfreiheit, die andere gemacht haben, aber auch ich wollte gern den anderen Teil meiner Stadt sehen, bevor ich Rentner sein würde, wollte Bands erleben, die bei uns nicht spielten und hätte als Zwölfjähriger all mein Erspartes geopfert, um einmal den FC Bayern im Münchner Olympiastadion zu sehen. Die Sehnsucht nach dem nicht Erreichbaren, ist ein starker Antrieb, das wurde gegen Ende der 80er-Jahre zunehmend sichtbar.
Vielleicht gehörte auch im Osten einfach ein bisschen Glück dazu: die richtige Kindergartentante, ein tolles Tandem aus Klassenlehrerin und Horterzieherin, eine gute Schule und, ja wirklich(!), eine charismatische Pionierleiterin. Dann konnte es das geben: kontroverse Diskussionen, freie Rede, interessante Gedanken. Nicht der Inhalt war reglementiert, sondern die Form: Höflichkeit, Achtung und Respekt waren in meiner Jugend ein Schlüssel zur Freiheit.
Unioner, die „Schlosserjungs“ aus Köpenick
Eine weitere Form von Freiheit fand ich in einem kleinen Fußballstadion am Rande der Wuhlheide in Köpenick. Zwölf Jahre alt war ich im Herbst 1986, als mein Vater mich zu einem Spiel des 1. FC Union Berlin mitnahm, vermutlich, um mein Fußballinteresse zu wecken und fortan gemeinsam mit mir und ungestört von meinem Wunsch nach der Sesamstraße die Sportschau sehen zu können. Es ist leidlich gelungen, wobei mich nicht der Fußball überzeugt hat, sondern das, was sich um das Spielfeld herum abspielte. Erwachsene Männer (und damals nur sehr wenige Frauen) sangen lauthals freche Lieder, schrien unflätige Worte, fielen sich um den Hals bei einem Tor ihrer Mannschaft oder fluchten, wie ich es zu Hause nie hätte tun dürfen. Hier suchte man keine Schlüssel zur Freiheit, hier wurde einfach das Schloss geknackt. Auch toll!
Union, nein, Unioner standen in dem Ruf, nicht ganz dem zu entsprechen, was man sich staatlicherseits unter sportlich-fairen Sportfreunden so vorstellte. Mich begeisterte etwas, das man heute vielleicht Alternativkultur nennt. Rau war es, radikal nicht unbedingt – eher augenzwinkernd und berlinerisch großmäulig. Das hatte was und es hatte einen Platz: Nur im Stadion gab es diesen Freiraum und das hat mir einige Zeit auch gereicht.

Christian Arbeit ist Stadionsprecher des 1. FC Union Berlin. Abbildung: 1. FC Union Berlin
Im Herbst 1989 hat es das nicht mehr und rückblickend fällt es mir schwer, mich zu erinnern, wie es dazu eigentlich kam. Zu viele Bilder vielleicht? Ungarische Grenze, Prager Botschaft, Dresdner Bahnhof, die ersten Demonstrationen, Wasserwerfer und Polizeihunde – irgendetwas ist damals gekippt. Die sagenumwobene Freiheit entwickelte einen unaufhaltsamen Sog, der Kampf darum und gegen das Bisherige fühlte sich kraftvoll und mächtig an; ihr Genuss mündete in einen fantastischen Rausch. Die gut zwei Monate zwischen dem 7. Oktober und dem 9. November sprengten jedes Zeitgefühl – waren sie blitzschnell vorbei oder dauerten sie ewig? Ich weiß es nicht mehr.
Wie der Tag auf die Nacht folgte auf den Rausch der Kater und auch das dauerte nicht allzu lange. Welchen Traum hatten wir denn geträumt, wo wollten wir denn hin? „Dieses Land ist es nicht!“, hatten wir unserer kleinen DDR wütend entgegengeschleudert. Das waren Rio Reisers Worte und er hatte sie für sein Land geschrieben, die Bundesrepublik Deutschland. In diesem Land waren wir recht schnell gelandet. Viele von uns wollten da unbedingt hin und hatten mit ihrer Stimme bei den Wahlen im März 1990 die Weichen dafür gestellt. Andere hatten von etwas anderem geträumt, einem eigenen Weg, einer neuen Idee – vielleicht sogar für beide deutschen Staaten. Dazu ist es nicht gekommen. Zu vage die Aussichten, zu verlockend die Versprechungen, zu groß das Bedürfnis nach Anlehnung an den großen, reichen Westen. So wie alles in dieser Zeit viel zu schnell ging, folgte auch die Ernüchterung auf dem Fuße. Arbeitslosigkeit, Geldsorgen, Zukunftsängste – das hatten wir nicht gekannt und es hatte uns auch nicht gefehlt. Nun gab es all das, und es verfehlte seine Wirkung nicht.
Stolz und Würde kommen schnell unter die Räder, wenn du als Krankenschwester deine Station mit dem Anspruch geleitet hast, kranken Kindern zu geben, was sie brauchen, um gesund zu werden – Medizin, Zuwendung, Zeit –, und nun aber Geld für den Krankhausbetreiber verdienen sollst. Betten belegen mit lohnenswerteren Fällen, Betten freimachen, wenn die Belegung sich nicht rechnet. Und der Maschinenbauingenieur an der Bauakademie? Geht putzen, statt Instandhaltungskonzepte für Industrieanlagen zu entwickeln. Oder fährt Kurierdienste mit dem alten Shiguli, um nur eines nicht zu sein: arbeitslos. Alles, nur nicht das.

Am 20. September 2023 spielte der 1. FC Union Berlin sein erstes Champions-League-Spiel – bei Real Madrid. Abbildung: 1. FC Union Berlin
Es gibt nichts zu beklagen?
Was meinen Eltern und zu vielen ihrer Generation verwehrt blieb, war mir vergönnt. Alle Türen standen offen. Abitur, ein Jahr London, Studium, Familie, eigenes Haus, ein erfüllender Beruf und mein Verein, der 1. FC Union Berlin, schaffte es vor gut einem Jahr bis in die Champions League … Einiges wäre auch in der DDR möglich gewesen, anderes nicht oder nicht annähernd auf gleiche Weise. Was also gibt es dann eigentlich zu beklagen? Und das gibt es doch, oder?
Ja, das gibt es. Aber es ist – Überraschung – etwas ganz Anderes als das, was mich Mitte der 80er beschäftigt hat. In schöner Regelmäßigkeit beschleicht mich ein interessantes Gefühl: Es gibt da eine sehr spezielle Art der Freude, wenn ich zum Gate eines Fluges nach London oder Paris laufe. Sie speist sich nicht aus der Aussicht auf ein wunderbares Ziel, sondern aus der Zufriedenheit, dieses Land zu verlassen. Das Land, nicht die Stadt. Berlin ist mein Zuhause und schenkt mir, was Deutschland mir nicht geben kann: Vertrautheit und Heimat.
Klingt nach einem hohen Ross, gesattelt mit Undankbarkeit. Was hat dieses Land mir denn zu geben? Was gebe ich ihm denn? Wenn wir uns auf ein freundliches „Nichts“ einigen könnten, wäre vielleicht schon alles gesagt. Aber das ist genau die Stelle, an der es dann eben hakt zwischen Ost und West – oder knallt, je nach Temperament. Wenn ich irgendwo OST hinschreibe, hebt WEST die Augenbrauen: Ach ja? OST? Und was ist mit der Stasi? Und dem Mangel? Dem Staatsdoping? Der Mauer? Alles vergessen? Na schönen Dank! Wir haben euch aufgenommen und in die Arme geschlossen und immer noch jammert ihr eurem piefigen Unrechtsstaat hinterher.
Aber nein! Eben nicht! In den seltensten Fällen tritt jemand auf, der die alte DDR wiederhaben möchte. Die Sinnfrage ist es, auf die keine Antwort mehr zu finden ist. Wofür das alles? Was wollen wir erreichen?

Einmal den FC Bayern sehen – für Christian Arbeit wurde ein Kindheitstraum wahr, mehrmals. Abbildung: 1. FC Union Berlin
Frieden auf der ganzen Welt und ein lebenswertes Leben für alle Menschen – das war die Zukunftsidee in meiner Kindheit und Jugend. Eine Welt frei von Ausbeutung und Unterdrückung war das Ziel und viele große Denker der Menschheit hatten Wege skizziert, wie wir dorthin gelangen könnten. Wenig ist davon geblieben. Das Ende der Geschichte, die beste aller Welten – jeder schmiedet noch ein bisschen an seinem persönlichen kleinen Glück herum und wer nichts Brauchbares zustande bringt, den versorgen wir leidlich und erklären ihm freundlich-bestimmt, in welche uns genehmen Bahnen er seine Wut bitte lenken möge. Das wird auf Dauer nicht reichen, davon bin ich überzeugt.
Und nun? Soll das so enden? Nein, das sollte es nicht und wir haben es in der Hand. Eine elementare Erfahrung OST kann dabei helfen und ist es allemal wert, beizeiten in Betracht gezogen zu werden: Nichts ist für immer, nichts bleibt, wie es war. Denn so, wie es ist, kann es nicht bleiben. Dafür, und das ist ausdrücklich kein Vorwurf, ist es einfach nicht gut genug.

Seit 2003 findet im Stadion An der Alten Försterei das Weihnachtssingen statt. Abbildung: 1. FC Union Berlin
Christian Arbeit
GEBOREN: 1974/Ostberlin
WOHNORT (aktuell): Ostberlin
MEIN BUCHTIPP: Peter Richter: „89/90“, 2017
MEIN FILMTIPP: „Anderson“, 2014
MEIN URLAUBSTIPP: Putgarten (Rügen)
 BUCHTIPP: BUCHTIPP:
„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Dieser Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2024, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |