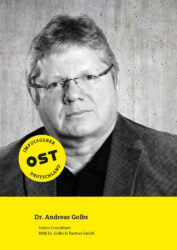Dr. Andreas H. Apelt, Publizist, Schriftsteller, Mitbegründer, Beauftragter des Vorstandes Deutsche Gesellschaft e.V., ist ein wichtiger Impulsgeber für Ostdeutschland. Er setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist er auch im zweiten Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.

Dr. Andreas H. Apelt, Publizist, Schriftsteller, Mitbegründer, Beauftragter des Vorstandes Deutsche Gesellschaft e.V. Abbildung: Yasin Jonathan Kandil
„Es ist ein stilles Sterben hier.“ Mit diesem Titel überschrieb ich im Oktober 1989 einen Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der Erfahrungsbericht aus dem Ostberliner Prenzlauer Berg musste mit der amerikanischen Botschaftspost in den Westen geschmuggelt werden. Denn noch existierten die DDR und die Mauer. Und das Strafgesetzbuch sah wegen der staatsfeindlichen Verbindungen drakonische Strafen von bis zu fünf Jahren Gefängnis vor. Zum Glück geschah mir nichts. Es hätte anders kommen können. So wie am 7. Oktober, ausgerechnet am 40. Geburtstag der DDR, als drei Stasischergen gewaltsam in meine Wohnung drangen und sich austobten.
Zum Feiern war an diesem Tag ohnehin niemandem zumute. Das Land war zum Sterben verurteilt. Es ist wie eine Pest, schrieb ich damals, eine Pest, die die alte Welt erfasste. Unverkennbar die Zeichen der Zeit: Briefe und Karten, die in den Hausfluren aus den verstopften Briefkästen quollen, in den Straßen abgestellte Autos, die keiner mehr bewegen würde, und herrenlos umherstreunende Hunde. Beim Bäcker der Zettel an der verriegelten Ladentür: Aus technischen Gründen geschlossen. Der Getränkehändler, der angeblich krank sei. Der Kioskverkäufer, der nicht einmal einen Zettel an die zugezogenen Rollos klebte.
Bleiben oder gehen war die Frage der Zeit. Sie quälte vor allem die Zurückgebliebenen, während sich in Prag, Budapest und Warschau die bundesdeutschen Botschaften mit Fluchtwilligen füllten. Wir klebten an den Fernsehröhren und sahen die alte Welt untergehen. Apathie machte sich breit, Hoffnungslosigkeit. Dann aber auch Trotz und Schadenfreude beim Blick auf die Fernsehberichte. Für die SED eine schallende Ohrfeige vor den Augen der Welt!
Die Bilder haben sich bis heute in mein Gedächtnis gebrannt. Denn nicht aufzugeben fiel den Menschen nicht leicht. Auch mir nicht, vor allem dann, wenn fast alle Freunde und die engsten Familienangehörigen ausreisten, über Ungarn flohen oder von genehmigten „Westreisen“ nicht zurückkamen. Wut machte sich breit, aber auch die Einsicht, diesen Teil Deutschlands nicht denen zu überlassen, die für den Niedergang verantwortlich waren.
Am stärksten wirkte die Gesellschaft da, wo Deutsche aus Ost und West gemeinsam für eine Sache stritten.”
Aufbruch trotz aller Hoffnungslosigkeit
Folgerichtig engagierte ich mich in der Oppositionsbewegung – ein Jahr zuvor hatte man mir das Forschungsstudium verweigert. Im Oktober 1989 wurde ich Mitbegründer der Vereinigung „Demokratischer Aufbruch“, später deren Berliner Landesvorsitzender. Im Herbst/Winter 1989/90 überschlugen sich die Ereignisse. Honecker wurde abgesetzt, das Politbüro trat ab, die Nationale Front zerfiel und die Modrow-Regierung versuchte trotz offener Grenzen und eines Runden Tisches, trotz Streiks und Demonstrationen zu retten, was zu retten ist. Nie zuvor gab es eine derartige Politisierung des gesamten öffentlichen Lebens. Innerhalb weniger Wochen wurde aus dem sterbenden dahinsiechenden Land ein politischer Hexenkessel, der den handelnden Akteuren alles abverlangte. Mit einem Mal waren die bislang nur vage formulierten Wünsche und Träume greifbar. Dazu zählte nicht nur die Beseitigung der SED-Diktatur, sondern auch die Wiederherstellung der deutschen Einheit.
Nicht der Westen machte den Druck, nein, der Osten gab hierfür den Ton an. Freilich unterstützt von jenen, die die Zeichen der Zeit erkannt haben. Allen voran Bundeskanzler Helmut Kohl, der seinerseits mit einem Zehn-Punkte-Plan vorlegte und eine Konföderation in Aussicht stellte. Zwar gab es auch in der DDR bekennende Vereinigungsgegner, die sich hinter den Aufruf „Für unser Land“ stellten, aber die Entwicklung konnten auch sie nicht aufhalten. Ich war froh, mittun zu können. Als Leiter des Arbeitskreises Deutschlandpolitik rief ich im Dezember 1989 zur Wahl einer Deutschen Nationalversammlung auf und stellte mich gemeinsam mit Gleichgesinnten hinter Helmut Kohls Zehn-Punkte-Plan. Zugleich nahm ich die Einladung einer kleinen, in Westberlin beheimateten Initiativgruppe an, die eine deutsch-deutsche Freundschaftsgesellschaft gründen wollte.
Die deutsche Einheit zu begleiten und zu befördern war auch mein Ziel. Die Gruppe um den Rechtsanwalt Jürgen Graalfs und Peter Brandt, einem Sohn des Altkanzlers, suchte bei den DDR Oppositionellen Verbündete, nachdem ein erster Anlauf Mitte der 1980er-Jahre am Widerstand der SED gescheitert war. Damals hatte Willy Brandt persönlich bei Honecker interveniert, wurde aber an Otto Reinhold verwiesen, der dann Jahre später die Absage des Politbüros überbrachte.
Mit der friedlichen Revolution bot sich eine neue Chance. Für die Initiatoren waren nun Vertreter der DDR-Oppositionsgruppen erste Ansprechpartner. Die SED blieb außen vor. Schon im Dezember 1989 waren die Vorbereitungen weit genug gediehen, ein politisch ausgewogenes Kuratorium gesucht und eine Satzung erarbeitet. Als Gründungsmitglieder bekannten sich unter anderem: Klaus von Bismarck, Willy Brandt, Günter de Bruyn, Eberhard Diepgen, Gottfried Forck, Ludwig Güttler, Harry Kupfer, Lothar de Maizière, Heiner Müller, Armin Mueller-Stahl, Elmar Pieroth, Jens Reich, Wolf Jobst Siedler und Manfred Stolpe. Am 13. Januar konnten wir zur festlichen Gründungsveranstaltung des ersten gesamtdeutschen Bürgervereins laden. Der Ort: die Berliner Nikolaikirche. Am Vortag wurde ich in den Vorstand gewählt und es wurde entschieden, den Verein Deutsche Gesellschaft zu nennen. Dazu der passende Untertitel: Gesellschaft zur Förderung politischer, kultureller und sozialer Beziehungen in Europa. Unser Ziel: den Einigungsprozess zu begleiten und zu befördern. Dementsprechend beschworen auch die Redner in der Kirche im Nikolaiviertel ihre Vorstellungen. Unter ihnen Johannes Rau, damals Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, Eberhard Diepgen oder Helga Schubert.

Jährliche Preisvergabe im Atrium der Deutschen Bank. Abbildung: Kranert, Jet-Foto
…, was zusammengehört
Doch nun begann die eigentliche Arbeit. Klangvolle Namen für die Mitgliedschaft waren schnell gefunden. Doch welche Projekte sollten gefördert werden? Und wie, wenn es doch keinerlei Apparat, keine Mitarbeitenden und erst recht kein Geld gab? Als zunächst ehrenamtlicher „Geschäftsführer“ stellte ich meine Wohnung im Prenzlauer Berg zur Verfügung. Die bald eingestellte Sekretärin saß am Küchentisch, ich in meinem Arbeitszimmer. Zu den ersten Aktivitäten zählten die Organisation von Informationsveranstaltungen zur bevorstehenden Wirtschafts- und Währungsunion. Sabine Bergmann-Pohl, die damals Rede und Antwort stand, ist heute eine der Vorsitzenden. Doch während dies vergleichsweise geräuschlos über die Bühne ging, war der von uns organisierte „Sommer der Begegnung“ nicht nur der erste deutschdeutsche Jugendaustausch, sondern auch das erste große Highlight des Vereins. Dabei vermittelten wir über 2.000 junge Menschen in Familien, die im jeweils anderen Teil Deutschlands lebten. Spektakulär waren bereits 1990 der Aufruf zum Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche, maßgeblich initiiert vom Vorstandsmitglied Ludwig Güttler, oder unser Engagement für die Industriearchitektur in Rüdersdorf, den Erhalt von Altlandsberg und die Umnutzung von Schloss Rheinsberg. Letzteres war zugleich der Startschuss für die Arbeit des Freundeskreises Schlösser und Gärten, der inzwischen allein mehr als 180 Publikationen über die oft vom Verfall bedrohten Schlösser und Herrenhäuser im Osten Deutschlands herausgegeben hat.

Kanzlerin zu Gast. Apelt, Müntefering, Merkel, de Maizière. Abbildung: Kranert, Jet-Foto
Arbeit gab es von Anfang an genug. Dazu zählten auch die zahlreichen Konferenzen, die die Auseinandersetzung mit den deutschen Diktaturen thematisierten, aber auch einen offenen Dialog über die vielfältigen deutsch-deutschen Vorurteile, Missverständnisse und Probleme im Zuge des Vereinigungsprozesses zuließen. Am stärksten wirkte die Gesellschaft da, wo Deutsche aus Ost und West gemeinsam für eine Sache stritten. Bezeichnend war eine von uns initiierte Münzaktion, bei der eine Währungsunions- Mark mit einem Spendenanteil dank des Engagements der Sparkassenverbände Ost und West reißenden Absatz fand und uns so die erste größere Geldsumme in die Kassen spülte. Bald folgten neue Projekte, Kongresse, Seminare, Konzerte, Lesungen, Bildungsreisen, Buchprojekte, Wettbewerbe und Zeitzeugengespräche. Und es konnten immer neue Mitstreiter gewonnen werden, denen das Zusammenwachsen Deutschlands am Herzen lag. Zu nennen sind hier Friede Springer, Tessen von Heydebreck, Angela Merkel, Wolfgang Thierse, Hans-Dietrich Genscher, Linda Teuteberg, Friedrich Schorlemmer, Franz Müntefering, Richard Schröder und Harald Eisenach.

Jubiläumsfeier „30 Jahre Deutsche Gesellschaft e.V.“ mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Abbildung: Deutsche Gesellschaft e.V.
Freiheits- und Einheitsdenkmal
Gemeinsam stritten wir aber auch für die Errichtung eines nationalen Freiheits- und Einheitsdenkmals in Berlin. Denn warum sollten wir uns denn nicht mit Stolz an die friedliche Revolution als eine Sternstunde deutscher Freiheits- und Einheitsgeschichte erinnern? Das Projekt, einst initiiert von den Kuratoriumsmitgliedern Florian Mausbach, Günter Nooke, Jürgen Engert und Lothar de Maizière, „adoptierten“ wir 2005 nach dem ersten Scheitern im Deutschen Bundestag. Innerhalb von zwei Jahren ließen sich neue parlamentarische Mehrheiten finden, doch trotz des Beschlusses des Hohen Hauses und umfangreicher Baumaßnahmen wartet der Sockel an der Schlossfreiheit noch immer auf seine neue Nutzung. Die Deutsche Gesellschaft e.V., bereits 2008 für ihr Engagement mit dem Nationalpreis ausgezeichnet, wird auch zukünftig für das Denkmal streiten. Denn für uns gilt der Satz Richard Schröders: „Kein Mensch und auch kein Volk kann allein aus seinem Versagen Orientierung gewinnen und schon gar nicht Ermunterung.“
So bleibt auch 35 Jahre nach der Gründung des Vereins noch viel zu tun. Und das, obgleich er deutschlandweit und in über 20 Ländern mit jährlich über 700 Veranstaltungen zu den aktivsten deutschen Nichtregierungsorganisationen zählt. Fürwahr ein deutsches Erfolgsmodell. Am Gründungsort der Deutschen Gesellschaft drängte es den Bundespräsidenten 2020 zu der Bemerkung: „Wenn es den Verein nicht schon gäbe, dann müsste man ihn gerade jetzt erfinden.“

Bis heute streitet die Deutsche Gesellschaft e.V. für die Realisierung des Freiheits- und Einheitsdenkmals. Abbildung: Milla & Partner
Dr. Andreas H. Apelt
GEBOREN: 1958/Luckau
WOHNORT (aktuell): Eichwalde bei Berlin
MEIN BUCHTIPP: Andreas H. Apelt: „Sechsunddreissig Seelen“, 2024
MEIN FILMTIPP: „Barbara“, 2012
MEIN URLAUBSTIPP: Kloster auf Hiddensee
 BUCHTIPP: BUCHTIPP:
„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Auch dieser zweite Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die weiteren 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Band 2, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2025, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |