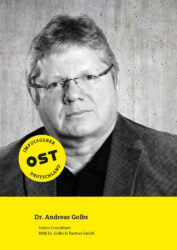Christian Bollert, Gründer und Geschäftsführer des Podcast-Radios detektor.fm (BEBE Medien GmbH), ist ein wichtiger Impulsgeber für Ostdeutschland. Er setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist er auch im zweiten Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.

Christian Bollert, Gründer und Geschäftsführer Podcast-Radio detektor.fm (BEBE Medien GmbH). Abbildung: detektor.fm, Susann Jehnichen
Die ostdeutschen Bundesländer haben in den nächsten Jahren eine historische Chance. Denn sie können zu innovativen wirtschaftlichen Vorreitern in Deutschland werden. In kaum einer anderen deutschen Region sind die Voraussetzungen für den von vielen Seiten geforderten digitalen Neustart momentan so günstig wie in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. 35 Jahre nach der Wiedervereinigung ist die Infrastruktur im direkten Vergleich mit westdeutschen Bundesländern hochmodern. Es gibt kaum noch industrielle Altlasten, das Betreuungsangebot für Familien ist sehr gut ausgebaut und die Hochschulen bilden junge Fachkräfte aus. Ähnlich wie Bayern und Baden-Württemberg nach 1945 haben die ostdeutschen Bundesländer ein besonderes Potenzial für einen wirtschaftlichen Neustart. Dabei darf es nicht darum gehen, möglichst große Industrieanlagen aufzubauen. Die Region hat die Chance, moderne und zukunftsfähige Technologien anzusiedeln und eine kleinteilige und krisenresistente Wirtschaftsstruktur aufzubauen.
Die ostdeutschen Bundesländer können das innovative Zentrum und der Treiber der deutschen Wirtschaft werden.”
Ostdeutschland als Estland Deutschlands
Die ostdeutschen Bundesländer können das innovative Zentrum und der Treiber der deutschen Wirtschaft werden. Ähnlich wie Estland in Europa haben die fünf Länder die Chance, eine besonders innovative Region in der Bundesrepublik zu werden. In den letzten Jahren sind auffallend viele digitale Innovationen in den ostdeutschen Bundesländern entwickelt worden. So hat beispielsweise das dezentrale soziale Netzwerk „Mastodon“ von Eugen Rochko seine Anfänge in Jena, in Fürstenberg haben Anke und Daniel Domscheit-Berg mit dem „havel:lab“ eine ländliche Digitalwerkstatt mit zivilgesellschaftlichen Wirkungen aufgebaut und Frederik Fischer liefert mit „Neulandia“ digitale Impulse für ländliche Regionen wie Wittenberge oder Wiesenburg.
Mit dem politischen Magneten Berlin im Zentrum haben die ostdeutschen Bundesländer die vermutlich dynamischste Großstadt Europas als Pulsgeber. Gleichzeitig zeigt die Geschichte, dass Innovationen oft eben nicht aus den Zentren, sondern aus der Peripherie stammen. In den vergangenen 35 Jahren hat sich gerade im Umfeld der Wirtschaft eine lebendige Zivilgesellschaft aufgebaut. Im Jahr 2025 ist gesellschaftliches Engagement, sicher auch wegen der Herausforderungen der vergangenen und der kommenden Jahre, für Unternehmen und Verbände eine zentrale Aufgabe geworden.

Christian Bollert auf der Leipziger Buchmesse. Abbildung: Ina Lebedjew
Erneuerbare Energien als Treiber
Besonders die Transformation der Wirtschaft hin zu Klimaneutralität und Nachhaltigkeit bietet für die ostdeutschen Regionen Chancen. Denn im Gegensatz zu etablierten Wirtschaftsregionen im Westen oder Süden Deutschlands sind hier die notwendigen Flächen für Solar- und Windenergie vorhanden und nutzbar. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt das große Potenzial von Solar- und Windenergie in den ostdeutschen Bundesländern und das wird sich in den kommenden Jahrzehnten noch vergrößern. Industrielle Altlasten der DDR sind in den vergangenen 35 Jahren in den meisten Orten demontiert und renaturiert worden. Die moderne Infrastruktur für Autobahnen, Schienen oder Stromnetze ermöglicht den weiteren schnellen Ausbau erneuerbarer Energien und den Anschluss externer Lieferanten wie Offshore-Anlagen und Länder wie Dänemark, Norwegen oder Schweden. Die sehr lebendige und produktive Forschungslandschaft bietet ideale Voraussetzungen für eine positive Entwicklung. Dazu gehören neben Universitäten und Fachhochschulen insbesondere auch Forschungsinstitute der großen Wissenschaftsgesellschaften. Fast alle ostdeutschen Bundesländer haben in den vergangenen Jahren wissenschaftliche Leuchttürme aufgebaut oder deren Gründung beschlossen. Dazu gehören beispielsweise das Deutsche Zentrum für Astrophysik in Görlitz oder das Center for the Transformation of Chemistry in Sachsen-Anhalt und Sachsen. Beim Aufbau und der Finanzierung können die „Kohlemilliarden“ helfen, die zur Abfederung des Strukturwandels bis 2038 im Mitteldeutschen Revier und in der Lausitz eingesetzt werden sollen.
Gerade flächenintensive Start-ups aus der Klimatechnologie- Branche können in den ostdeutschen Bundesländern besonders günstige und attraktive Standorte nutzen. Hier könnten gezielte Ansiedlungen und Kooperationen mit Initiativen wie „Tech for Net Zero“ und regionalen Forschungseinrichtungen Impulse setzen. Klassische Energieunternehmen wie die VNG AG oder die Verbio SE sitzen bereits in der Region und können mithelfen, die Transformation zu einer klimaneutralen Energiewirtschaft voranzutreiben. Durch bereits gestartete und geplante Neuansiedlungen wie Tesla in Grünheide oder TSMC in Dresden werden zusätzliche Impulse für Zulieferer und Spezialisten von nachhaltigen und digitalen Produkten entstehen.
Insbesondere im Bereich der neuen Industrie wie beispielsweise beim grünen Wasserstoff spielen ostdeutsche Akteure bereits heute eine zentrale Rolle. Das Dresdener Unternehmen Sunfire gehört längst zu den europäischen Vorreitern beim Thema Wasserstoff. Es baut seit Jahren im großen Maßstab Elektrolyseure für die Gewinnung von umweltfreundlich erzeugtem Wasserstoff. Dabei ist es fast schon symbolisch, dass Sunfire heute im ehemaligen Bremsenwerk für Trabis in Limbach-Oberfrohna Bauteile für Elektrolyseure („Stacks“) herstellen lässt. Zuletzt sind dort von Continental noch Bauteile für Dieselmotoren produziert worden – mittlerweile fertigen die ehemaligen Autospezialisten Teile für die klimaneutrale Industrie. Vor allem von der TU Dresden kommen wichtige Forschungsimpulse für klimaneutrale Technologien wie beim grünen Wasserstoff.

Die Voraussetzungen für einen digitalen Neustart sind in Ostdeutschland besonders günstig, ist Christian Bollert überzeugt. Abbildung: Ina Lebedjew
Von Estland das Lernen lernen
Während die ostdeutschen Bundesländer im innerdeutschen Bildungsvergleich seit Einführung von Vergleichstests wie Pisa oder Iglu immer verhältnismäßig gut abschneiden, gibt es international noch erheblichen Aufholbedarf. Hier können die ostdeutschen Bundesländer noch mutiger von skandinavischen Ländern wie Finnland oder Schweden und insbesondere Estland lernen. Estland ist bei der Bildungspolitik deshalb besonders gut geeignet, weil Estland seit den 1990er-Jahren ebenfalls eine gesellschaftliche Transformation von einer sozialistischen Diktatur hin zu einem demokratischen Staat durchlaufen hat. Kulturelle und soziale Indikatoren sind dadurch deutlich näher an den Realitäten der Menschen in den ostdeutschen Bundesländern. Außerdem können gerade Flächenländer wie Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen- Anhalt oder Thüringen von Erfahrungen und Lösungen aus dem besonders dünn besiedelten Estland (31,4 Einwohner pro Quadratkilometer) lernen. Längeres gemeinsames Lernen (neun Jahre), Chancengleichheit und individuelle Förderangebote sind nur drei Gründe für den estnischen Bildungserfolg.
Die bestehende Infrastruktur mit Krippen, Kindergärten und Ganztagsangeboten in Schulen ist ein ideales Fundament, um die bereits hohe Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch weiter auszubauen und im Vergleich mit westdeutschen Bundesländern zu punkten.
Nicht zuletzt studieren in den ostdeutschen Bundesländern bereits talentierte und gut ausgebildete Fachkräfte. Hier werden auch überdurchschnittlich viele Patente entwickelt und angemeldet. Dieses bestehende Fundament müsste stärker für Ausgründungen genutzt werden. Zudem sollten talentierte Forschende auch nach Studium oder Promotion in der jeweiligen Region gehalten werden. Zu den Aufgaben gehört hier ebenfalls das Akkumulieren von Kapital. Für eine erfolgreiche Entwicklung ist schließlich auch in suburbanen und ländlichen Regionen eine weltoffene Willkommenskultur unbedingt notwendig.

Cover des Podcasts „Deutschland – ein halbes Leben. 35 Jahre Mauerfall“ mit einer Illustration des Hosts Christian Bollert. Abbildung: MDR, detektor.fm
Digital ist besser!
Insbesondere bei der Digitalisierung bieten sich in den ostdeutschen Bundesländern besondere Chancen. Zum einen sind digitale Angebote in Verwaltung und Politik aufgrund der Bevölkerungsentwicklung der vergangenen 35 Jahre dringend erforderlich, zum anderen bieten sie große Entwicklungspotenziale. Von digitalen Leuchttürmen wie Schleswig-Holstein (Open-Source-Software, Digitalisierung der Verwaltung) oder Estland können sich ostdeutsche Bundesländer inspirieren lassen und eigene Lösungen bauen.
Die in den letzten Jahrzehnten modernisierte Infrastruktur in den ostdeutschen Bundesländern kann mit einem ambitionierten flächendeckenden Glasfaserausbau endgültig zukunftsfähig gemacht werden. Galt Internet „an jeder Milchkanne“ noch vor ein paar Jahren auf der politischen Bühne eher als Scherz, bietet Glasfaserinternet längst echte Wachstumschancen für ländliche Regionen. Das Beispiel der Stadt Stendal zeigt, welche Wirkung ein konsequenter Ausbau der Glasfaserinfrastruktur für eine Stadt und eine ganze Region haben kann. Spätestens seit der Coronapandemie sind viele junge und gut ausgebildete Leute bereit, die Großstädte zu verlassen und in ländliche Regionen zu ziehen, wenn sie dort ihren jeweiligen Jobs nachgehen können. Dafür ist schnelles Glasfaserinternet neben einem Bahnanschluss eine zwingende Voraussetzung. Die lebenswerten Landschaften erlauben in vielen ostdeutschen Regionen ein naturnahes Leben und bieten auch im Jahr 2025 noch ausreichend Freiräume für neue Ideen.
Regionale Initiativen wie der Zweckverband Breitband Altmark und ihre beachtlichen Erfolge sind ein Fingerzeig für das immense Potenzial gerade für ländliche Regionen in den ostdeutschen Bundesländern. Gleichzeitig zeigen solche Projekte, dass neue gemeinwohlorientierte Lösungen große Entwicklungspotenziale ermöglichen.
Modern, klimaneutral und digital
Nimmt man all diese Ansätze zusammen, gibt es 35 Jahre nach der Wiedervereinigung immense Chancen für die ostdeutschen Bundesländer. Politik, Unternehmen und die jeweiligen regionalen Gemeinschaften haben das Potenzial, in den nächsten 35 Jahren große Entwicklungsschritte zu gehen und aus den abgehängten Regionen der 1980er- und 1990er-Jahre moderne, klimaneutrale und digitale Vorzeigeregionen zu machen.
Nüüd alustame!
Christian Bollert
GEBOREN: 1982/Potsdam
WOHNORT (aktuell): Leipzig
MEIN BUCHTIPP: Steffen Mau: „Ungleich vereint. Warum der Osten anders bleibt“, 2024
MEIN DOKUTIPP: „Wut. Die Reise geht weiter“, 2025
MEIN URLAUBSTIPP: Darsser Weststrand
 BUCHTIPP: BUCHTIPP:
„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Auch dieser zweite Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die weiteren 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Band 2, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2025, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |