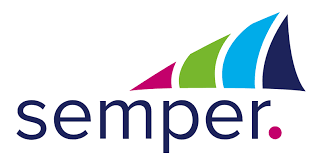Carsten Schneider, der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, ist ein wichtiger Impulsgeber für Ostdeutschland. Er setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist er auch in dem Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.

Carsten Schneider, Staatsminister, Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland, SPD. Abbildung: Bundesregierung/Steffen Kugler
Denke ich an Ostdeutschland, dann denke ich an viele schöne Landstriche: an weite Sandstrände in Mecklenburg oder beeindruckende Felsformationen in der Sächsischen Schweiz. An Wanderungen durch den Thüringer Wald oder durch Brandenburger Weiten. An das aufregende Großstadtleben in Berlin oder Leipzig, an Kulturschätze in Dresden oder Weimar, an historische Orte wie die Wartburg oder die Lutherstadt Wittenberg.
Ostdeutschland ist heterogen. In seinen Landschaften ebenso wie in den gesprochenen Mundarten oder den kulturellen Eigenheiten. Das liegt auch daran, dass Ostdeutschland viel größer ist als der tatsächliche geografische Osten Deutschlands, also die Region vor Oder und Neiße. Ostdeutschland steht vielmehr als Synonym für das gesamte Gebiet, das bis 1990 zur DDR gehörte. Das sind ganze 108.000 Quadratkilometer, die bis in die geografische Mitte Deutschlands reichen.
Es sind vor allem die realsozialistische Vergangenheit und die Transformationserfahrung der 1990er-Jahre, die Ostdeutschland auf einen gemeinsamen Nenner bringen. So unterschiedlich Land und Leute auch sein mögen: Sie haben einen historischen Erfahrungshintergrund, der sie eindeutig von „Westdeutschland“ unterscheidet.

Staatsminister Carsten Schneider im Rahmen seiner Pressereise beim Ortstermin Sozialistische Planstadt und Besuch der Kulturfabrik mit der Autorin Grit Lemke. Hoyerswerda, Sachsen, 30. August 2023. Abbildung: Bundeskanzleramt/bundesfoto/Christina Czybik
Die Geburtsstunde ostdeutscher Identität
Meiner Meinung nach waren die Nachwendejahre noch prägender für die Entwicklung eines ostdeutschen Bewusstseins als die 40 Jahre davor. Nach der friedlichen Revolution und der deutschen Einheit änderte sich für die Menschen in der ehemaligen DDR innerhalb kürzester Zeit alles. Während in den alten Bundesländern der Alltag normal weiterging, waren die Ostdeutschen mit einer implodierten Staatsmacht, einem zusammenbrechenden Wirtschaftssystem, dem Verlust von Millionen von Arbeitsplätzen, einem grundlegenden gesellschaftlichen Wandel und der Abwanderung von Millionen Menschen konfrontiert.
Gerade für die Generation meiner Eltern ging diese Zeit mit dramatischen Brüchen im Lebenslauf einher. Menschen, die vor dem Mauerfall fest im Berufsleben etabliert waren und ihre Familie gut versorgen konnten, verloren plötzlich ihre Arbeit. Nur selten gelang ihnen ein reibungsloser beruflicher Neustart. Ihre Ausbildungsabschlüsse wurden im bundesrepublikanischen System oft nicht anerkannt. Gingen sie „in den Westen“, um dort eine Arbeit aufzunehmen, mussten sie sich in der Hierarchie ganz weit hinten anstellen und verdienten deutlich weniger als ihre westdeutschen Kollegen. Das waren keine Einzelschicksale. In meiner Schulklasse, in meinem Freundeskreis hatte jede einzelne Familie einen Jobverlust, eine berufliche Degradierung oder eine Neuorientierung zu verkraften.
Das war eine Zeit, in der die Erwachsenen stark mit sich selbst beschäftigt waren. Es war auch eine Zeit der gefühlten Entstaatlichung. Hatte der Staat wenige Monate zuvor noch alle Bereiche des Lebens durchdrungen, war mit dem Sturz des SED-Regimes ein Machtvakuum entstanden. Die staatlichen Institutionen zogen sich verunsichert zurück und ließen viele Dinge einfach geschehen. Nach der Wiedervereinigung brauchte es dann einige Zeit, bis sich die neuen Strukturen etabliert hatten.
Es begannen die Baseballschlägerjahre. Eine Zeit der Orientierungs- und Heimatlosigkeit, die vielerorts von Gewalt im öffentlichen Raum geprägt war. Sie war hoch gefährlich gerade für junge Menschen. Beinahe täglich fanden Überfälle und Schlägereien statt. Auch bei uns in Erfurt. Die staatlichen Autoritäten schritten oft nicht entschieden genug ein. Seitdem weiß ich, dass ein starker Staat, wenn er demokratisch legitimiert ist, nichts Anrüchiges ist. Für mich ist er vielmehr die Grundbedingung für Freiheit.
Wir Ostdeutschen bringen ein ungeheures Potenzial mit, von dem Deutschland als Ganzes profitieren kann.”
Das große Glück der Wiedervereinigung
Trotz der Brutalität und der Brüche der frühen 1990er-Jahre war die Wende für mich vor allem eines: ein großer Glücksfall. Noch keine 14 Jahre alt, war ich im September 1989 in das Büro meiner damaligen Schuldirektorin bestellt worden. Dort warteten zwei NVA-Offiziere auf mich. Ob ich mich verpflichten wolle, fragten sie. Ich drückte mich um eine sofortige Antwort herum und erklärte, zuerst mit meinen Eltern sprechen zu müssen. Zu einem zweiten Rekrutierungsversuch ist es nie gekommen. Zwei Monate später fiel die Mauer. Die friedliche Revolution bewahrte mich vor einer schwierigen Entscheidung. Auch wenn ich weiß, dass Helmut Kohls Formulierung seinerzeit umstritten war: Ich empfinde das tatsächlich und voller Dankbarkeit als „Gnade der späten Geburt“.
Ähnlich wie mir ging es einer ganzen Generation von jungen Menschen. Im wiedervereinigten Deutschland standen uns ganz neue Möglichkeiten zur Lebensgestaltung off en. Plötzlich konnten wir uns für oder gegen den Militärdienst entscheiden, ohne Konsequenzen zu fürchten. Wir konnten reisen, offen diskutieren, unseren Lebensweg ganz nach unseren Vorstellungen gestalten.
Auch mein Leben entwickelte sich in den 1990er-Jahren in eine ungeahnte Richtung. Die rechtsradikalen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen waren für mich dabei ein Schlüsselerlebnis. Die Bilder von brennenden Häusern, dem jubelnden Mob und der weitgehend hilflosen Staatsmacht haben mich politisiert. Ich wollte die Ereignisse nicht unwidersprochen hinnehmen, sondern ein Zeichen setzen. Zusammen mit Freunden gründete ich einen Verein. Wir nannten uns „kritische Alternative“ und gaben eine Zeitschrift für Jugendliche heraus. Einer Partei gehörte ich damals noch nicht an. Wir wollten unsere Leserschaft nicht von einer bestimmten politischen Position überzeugen. Wir wollten sie dazu bewegen, sich eine eigene Meinung zu bilden und dann auch öffentlich Stellung zu beziehen. Den rechten Parolen wollten wir eine Vielfalt demokratischer Stimmen entgegensetzen.
Über mein Engagement landete ich einige Zeit später erst bei den Jusos und 1995 schließlich in der SPD. Kaum drei Jahre darauf trat ich bei der Bundestagswahl für die SPD als Direktkandidat im Wahlkreis Erfurt an. Im September 1998 zog ich als jüngster Abgeordneter in den Deutschen Bundestag ein.

Staatsminister Carsten Schneider beim Besuch der Elbe Flugzeugwerke GmbH im Rahmen seiner Pressereise in Dresden, Sachsen, 31. August 2023. Abbildung: Bundeskanzleramt bundesfoto/Christina Czybik
Wir Ostdeutschen hatten es nicht einfach, …
Die ersten Jahre im Bundestag waren nicht einfach. Wie alle jungen Parlamentarierinnen und Parlamentarier machte ich die Erfahrung, mich erst einmal einreihen und lernen zu müssen. Bei uns ostdeutschen Abgeordneten kamen jedoch weitere Erschwernisse hinzu: Allein schon wegen der Kräfteverhältnisse waren wir im Nachteil. Wenn Kampfkandidaturen um wichtige Posten anstanden, waren uns unsere Kollegen aus mitgliederstarken westdeutschen Landesverbänden überlegen. Außerdem waren wir nicht nur neu im Bundestag, sondern auch relativ neu in der SPD und der (gesamtdeutschen) Politik. Während die ostdeutschen Abgeordneten seit frühestens 1990 mitmischten, hatten die westdeutschen Protagonistinnen und Protagonisten der rot-grünen Koalition oft schon seit den 1970er-Jahren politische Schlachten miteinander geschlagen, Allianzen gebildet und das Handwerk des westdeutsch geprägten politischen Geschäfts von der Pike auf gelernt.
So speziell der Arbeitsplatz Bundestag sein mag: Ich weiß, dass es vielen Ostdeutschen meiner und der nachfolgenden Generationen ähnlich ging wie mir. Wir kamen zweifelsohne reibungsloser in Gesamtdeutschland an als unsere Eltern und Großeltern. Unsere Schul-, Berufs- und Studienabschlüsse hatten wir im wiedervereinigten Deutschland erworben. Wir waren formal gleich ausgestattet wie unsere westdeutschen Kollegen oder Kommilitoninnen, erlebten also keine kollektive Entwertung unserer bisherigen Berufs- und Bildungsbiografien. Dennoch machten wir allzu oft die Erfahrung, dass gleich qualifizierte Westdeutsche schneller Karriere machten als wir. Sie verfügten schlicht und einfach über ganz andere Ressourcen. Ihre Eltern waren im Durchschnitt erheblich vermögender als unsere. Vor allem aber waren sie gut vernetzt und mit dem System vertraut. Wir Ostdeutschen hingegen hatten wenig Vergleichbares, worauf wir ideell oder materiell zurückgreifen konnten. Diesen Zustand hat Jana Hensel in ihrem Buch „Zonenkinder“ sehr treffend beschrieben.
Diese Benachteiligungen wirken teilweise bis heute nach. Der von mir als Beauftragter für Ostdeutschland initiierte sogenannte „Elitenmonitor“ untersucht den Anteil von Ostdeutschen in Führungspositionen. Die Studie zeigt, dass auch mehr als drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung nur zwölf Prozent der Spitzenpositionen in Deutschland von gebürtigen Ostdeutschen ausgefüllt werden. Dabei liegt der Anteil der Ostdeutschen an der Gesamtbevölkerung bei 20 Prozent. Gerade in Führungspositionen neuralgischer Bereiche wie der Justiz, den Medien, der Wissenschaft oder der Wirtschaft sind Ostdeutsche nur im einstelligen Bereich vertreten.

Staatsminister Carsten Schneider bei der Vorstellung des zukünftigen Wasserstoffzentrums im Heizkraftwerk und zukünftigen Wasserstoffkraftwerk Chemnitz-Nord im Rahmen seiner Pressereise in Chemnitz, Sachsen, 31. August 2023. Abbildung: Bundeskanzleramt/bundesfoto/Christina Czybik
… doch genau darin liegt unser Potenzial
Als Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland ist es mir ein großes Anliegen, diesen Zustand zu ändern. Denn unser Land braucht den ostdeutschen Erfahrungsschatz mehr denn je:
Klimawandel und Rohstoffknappheit verlangen nach neuen Wegen des Wirtschaftens? Wir Ostdeutschen haben Erfahrung mit wirtschaftlichem Wandel! Unser politisches System wird von autoritären Kräften herausgefordert? Wir Ostdeutschen wissen aus der Geschichte, was Freiheit und Demokratie wert sind! Der Fachkräftemangel zwingt uns zu pragmatischeren Verfahren bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse? Das leuchtet uns Ostdeutschen ein. Hätten wir in den 1990er-Jahren auch gebraucht.
Kurzum, wir bringen ein ungeheures Potenzial mit, von dem Deutschland als Ganzes profitieren kann. Es macht mir Mut zu sehen, dass gerade jüngere Ostdeutsche ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. Sie begreifen ihre Ost-Erfahrung als wichtige Ressource in einer Welt im Wandel. Und sie wollen diese Welt mit aller Macht und auf allen Ebenen mitgestalten. So haben junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus dem Osten in den vergangenen Jahren mit eindrucksvollen Büchern auf sich aufmerksam gemacht. Sie verkörpern eine Ost-Identität, die der Zukunft zugewandt, weltoffen und avantgardistisch ist.
Ich wünsche mir sehr, dass diese neue Generation von „Nachwendekindern“ so selbstbewusst am Werke bleibt. Und ich hoffe, dass sie auch im Westen gehört wird. Schließlich kann es nur durch gegenseitiges Verständnis gelingen, die „Mauer in den Köpfen“ endgültig zu überwinden.
Carsten Schneider
GEBOREN: 1976/Erfurt
WOHNORTE (aktuell): Erfurt, Berlin
MEINE BUCHTIPPS: Steffen Mau: „Lütten Klein“, 2019; Werner Bräunig: „Rummelplatz“, 2007
MEIN FILMTIPP: „Karbid und Sauerampfer“, 1963
MEINE URLAUBSTIPPS: Rheinsberger Seen, Thüringer Städtekette
 BUCHTIPP: BUCHTIPP:
„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Dieser Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2024, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |