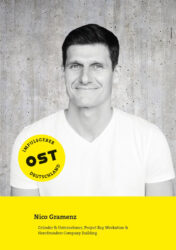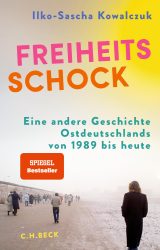Christin Bohmann, Chefredakteurin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), ist eine wichtige Impulsgeberin für Ostdeutschland. Sie setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist sie auch im zweiten Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.

Christin Bohmann, Chefredakteurin Mitteldeutscher Rundfunk (MDR). Abbildung: MDR/KIRSTEN NIJHOF
„Ich hab mich nie als Ostdeutsche gefühlt – schon gar nicht, als ich im Ausland gelebt habe.“ Das sagte mir kürzlich eine Freundin. Sie stammt wie ich aus Ostdeutschland, lebt heute in der Schweiz – und findet die andauernde Debatte über das „Ostdeutschsein“ eher ermüdend. Viele Ostdeutsche fühlen sich nicht ostdeutsch. Warum auch? Herkunft sollte kein Label sein. Und trotzdem bleibt sie relevant, ob gewollt oder nicht: in Lebensläufen, in Bewerbungsgesprächen, in Aufstiegsfragen.
Die klassische Karrierebibel sieht keine ostdeutschen Lebensläufe vor. Brüche, Lücken, nicht anerkannte Berufsabschlüsse und Wartezeiten fürs komplizierte Nachdiplomieren müssen erklärt werden. Viele ostdeutsche Biografien beinhalten genau das: Lebenswege mit plötzlichen Veränderungen, zweite und dritte Karrierepfade, Phasen von Arbeitslosigkeit und quälende Existenzfragen. Für viele Personalerinnen und Personaler sind das Warnzeichen, bisweilen Ausschlusskriterien.
Einseitige Darstellung untergräbt Vertrauen und verstärkt Entfremdung.”
Wäre da nicht die Realität
Das ist selbstverständlich nur ein Aspekt von vielen, warum Ostdeutsche in Führungspositionen immer noch unterrepräsentiert sind, wie der Elitenmonitor alljährlich zeigt. Aber die Diskrepanz ist weithin spürbar: zwischen dem Wunsch, Herkunft als irrelevant zu behandeln, und dem Fakt, dass Herkunft nach wie vor Aufstiegschancen beeinflusst.
Doch was die Gesellschaft, die Arbeitswelt, unsere Gemeinschaft durch die Sichtbarkeit dieser Brüche verpasst, wiegt aus meiner Sicht viel schwerer: Ostdeutsche Erfahrungen setzen sich aus Momenten des Perspektivwechsels zusammen, dem Wissen um die Unbeständigkeit des Status quo. Diese kollektive Erfahrung ist kein Makel, sondern eine Ressource – gerade in einer Zeit, die Wandel fordert. Diese Überzeugung hat einerseits biografische Ursprünge, andererseits ist sie Credo meiner Verantwortung als Chefredakteurin des MDR.
Ich bin 1987 in Gera geboren, aufgewachsen in den Neunzigerjahren in einem Ostdeutschland, das sich in vielerlei Hinsicht im Aufbruch befand und doch von Unsicherheit geprägt blieb. Für mich und meine Freunde war „ostdeutsche Identität“ in der Kindheit und lange darüber hinaus kein erklärtes Thema. Wir waren einfach, was wir waren. Vieles veränderte sich schnell: Landstraßen, Läden, Lehrpläne. Was wir davon bewusst mitbekamen, war vor allem Bewegung – kein Stillstand.

Christin Bohmann bei den Medientagen Mitteldeutschland zum Thema „Im Osten nichts Neues? Ostdeutschland in den Medien“. Abbildung: MTM/Daniel Reiche
Anerkennung für Anpassung
Die Prägung durch die Nachwendejahre zeigte sich für mich zunächst mehr in einem Grundgefühl der Elterngeneration als in konkreten Erzählungen: Anpassung war notwendig. Flexibilität war die Überlebensstrategie. Wer ging, waren oftmals Väter, die in den alten Bundesländern „auf Montage“ waren und nur am Wochenende heimkehrten. Wer blieb, waren die Mütter und Großeltern, ebenfalls eingebunden in einen selbstverständlichen, durch Arbeit oder Arbeitslosigkeit geprägten Alltag. Mein Leben, auch meinen Blick auf Arbeit, hat das bis heute geprägt. Der Wille, die Dinge selbst bestimmen zu können und unbedingt selbst handlungsfähig zu bleiben, ist an vielen Tagen Antrieb, an manchen bleibt die Erkenntnis: Nicht alles lässt sich mit eigener Motivation lösen, nicht alle Umstände sind selbst gestaltbar.
Trotzdem empfand ich damals nie, dass Herkunft mein Leben bestimmte. Ich war neugierig auf die Welt und begann nach dem Abitur 2005 ein Studium der Germanistik, Journalistik und Komparatistik. Erst als ich für ein Erasmus-Semester nach Dublin ging, wurde mir klar, wie stark Herkunft Identität prägen kann. Ich wechselte auf gewisse Weise unfreiwillig meine Perspektive. Im Ausland war ich plötzlich eine Deutsche – eine Zuschreibung, die mir bis dahin, oh ja, fremd gewesen war. Im Auslandssemester lernte ich das Fremdsein als einen Erfahrungsraum kennen. Herkunft war nicht mehr unsichtbar. Sie war Teil dessen, wie ich wahrgenommen wurde – und dann auch, wie ich mich selbst wahrnahm. Valerie Schönian hat das einmal als „Mehr-Werden“ beschrieben.
Nach meinem Studium und den ersten Berufsjahren war ostdeutsche Herkunft für mich dennoch weiter kein vordergründiges Thema. Ich sah mich als Teil einer Generation, die über Herkunft hinausdenken wollte – die sich nicht durch Grenzziehungen beschreiben ließ, sondern durch Offenheit und Neugier. Als ich meine ersten Schritte im Journalismus machte, wurde ich von einem Kollegen beim ersten Gespräch in der Redaktion in Berlin gefragt, woher ich denn komme. Ich erzählte ihm von meinem Geburtsort in Thüringen und dass ich unter anderem in Leipzig studiert hatte. Er bemerkte daraufhin gleichermaßen erstaunt wie lobend, dass man ja gar nicht an meiner Aussprache höre, dass ich aus dem Osten käme. Ich fand das schmeichelhaft, hatte ich mir beim Radio-Sprechtraining an der Uni kleinere dialektale Ausprägungen abgewöhnt, und es war wohl auch nett gemeint.
Ich kann mich nicht mehr an den Namen des Kollegen erinnern, wohl aber, wie mir nach und nach dämmerte, was ich da eigentlich als positiv empfunden hatte. Damals empfand ich die Bemerkung als Kompliment – ein Zeichen dafür, „angekommen“ zu sein. Heute, mit Abstand, zeigt sie mir, wie tief das ungeschriebene Ideal verankert war: Anpassung als Voraussetzung für Anerkennung.
In den vergangenen Jahren ist Ostdeutschland wieder stärker ins Zentrum gesellschaftlicher Debatten gerückt. Und dass Identität heute wieder eine stärkere Rolle spielt, hat viel mit den Multikrisen unserer Zeit zu tun. In einer Welt voller Unsicherheiten suchen Menschen nach Ankern – und Herkunft wird einer dieser Anker. Auch die ostdeutsche Erfahrung wird dadurch wieder sichtbarer: als Erzählung von Anpassung, Wandel und Gestaltungskraft.

Das Hochhaus der MDR-Zentrale in Leipzig. Abbildung: MDR/Robert Hensel
Ostdeutschland als Kompetenzraum
Als Chefredakteurin des Mitteldeutschen Rundfunks trage ich heute auch Verantwortung dafür, wie sichtbar ostdeutsche Lebenslagen in der Öffentlichkeit sind. Ich verstehe viele Menschen aus meiner Generation, wenn sie sagen, dass sie sich nicht ostdeutsch fühlen oder es ablehnen, qua ihrer Herkunft als Ostdeutsche benannt zu werden. Weil sie sich damit limitiert fühlen. Und dennoch: Ostdeutschsein ist für mich keine kulturelle Identität im klassischen Sinn. Vielmehr ist es eine geteilte Erfahrung, eine Summe von Erlebnissen, die viele Ostdeutsche miteinander verbindet, eine in Teilen gemeinsame Perspektive – unabhängig davon, ob sie heute in Leipzig oder in Stuttgart leben. Für mich bedeutet ostdeutsche Identität vor allem eines: eine gemeinsame Prägung durch Erfahrung. Die Sichtbarkeit und Akzeptanz ostdeutscher Erfahrungen ist daher auch keine Geste der Höflichkeit. Sie ist Anerkennung von Realität, und sie ist Voraussetzung für Vertrauen.
Unsere Gesellschaft steht heute unter Druck: wirtschaftliche Rezession, Ängste vor Krieg, globale Instabilität. Gerade jetzt können ostdeutsche Erfahrungen wichtig sein. Wer nach 1989 in Ostdeutschland aufgewachsen ist, weiß über die Erfahrungen der Elterngeneration und damit aus dem eigenen unmittelbaren Erleben, wie es ist, Sicherheiten zu verlieren und trotzdem neue Wege zu finden. Anpassungsfähigkeit, Pragmatismus und Gestaltungskraft sind Fähigkeiten, die heute dringender gebraucht werden denn je. Dieses Wissen gehört aktiv eingebunden: in die Gestaltung wirtschaftlicher Transformation, in neue Ansätze sozialer Gerechtigkeit, in politische Entscheidungsprozesse. Ostdeutschland ist kein Rückzugsraum. Es kann Kompetenzraum für das ganze Land sein.
Eine kürzlich veröffentlichte, aufwendige Analyse der Produktionsfirma Hoferichter & Jacobs in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig für den MDR zeigt, dass die überregionale Berichterstattung über Ostdeutschland häufig von wenigen etablierten Negativthemen geprägt ist. Mehr als 300 Millionen Presseartikel hat das Forschungsteam analysiert und dabei festgestellt, dass besonders zu Jahrestagen insgesamt stärker über Ostdeutschland berichtet und Ostdeutschland wieder zum „Besonderen“ erklärt wird. Und dass die Berichte häufig pauschalisieren und offensichtlich mit Stereotypen arbeiten anstatt mit Differenzierungen. Selten werden in Artikeln, die das Wort „ostdeutsch“ enthalten, positive Zuschreibungen verwendet. Machtlosigkeit und Benachteiligung sind viel stärker verbreitet als Erzählungen über Erfolge und Empowerment.
Diese einseitige Darstellung untergräbt Vertrauen und verstärkt Entfremdung. Als Chefredakteurin sehe ich es als meine Aufgabe, dem entgegenzuwirken: durch bewusste Vielfalt der Perspektiven in journalistischen Produkten, durch kontinuierliche Berichterstattung über ostdeutsche Lebenslagen, nicht nur bei Wahlen oder Krisen, und durch gezielte Dialogaktionen mit den Menschen vor Ort.

Christin Bohmann (links) bei einem Herbsttreffen der Medienfrauen. Abbildung: MDR/KIRSTEN NIJHOF
Perspektivwechsel ermöglichen
Gute Berichterstattung heißt in diesem Kontext auch, die eigene Prägung zu hinterfragen, andere Sichtweisen zu ermöglichen und von allen Teilen Deutschlands mit offenem Blick zu erzählen. Im Redaktionsalltag wird spürbar, wie unbewusste Normen wirken: Wenn Vermögen selbstverständlich vorausgesetzt wird, wo keines ist. Wenn weibliche Erwerbstätigkeit als Besonderheit verstanden wird, obwohl sie in Ostdeutschland die Regel war. Solche blinden Flecken zu erkennen, ist keine Kleinigkeit. Diese ständigen Perspektivwechsel sind zentral, um wirklich gerechte und vielfältige Erzählungen zu schaffen. Ein kritisches Bewusstsein für diese Unterschiede ist die Grundlage dafür, dass sich alle Menschen in medialen Bildern wiederfinden können – nicht nur ein Teil der Gesellschaft. Darum ist es umso wichtiger, dass wir Medienschaffenden diese Erfahrungen sichtbar, hörbar und vielleicht sogar erlebbar machen.
Wenn ich an die Zukunft denke, wünsche ich mir kein „Ostdeutschland“, das durch ideelle und mediale Grenzziehung besonders sichtbar bleibt. Ich wünsche mir vielmehr, dass die Unterscheidung zwischen Ost und West in den Köpfen und Strukturen irgendwann keine Rolle mehr spielt und gleichzeitig die regionale Verankerung und Sichtbarkeit mit Selbstbewusstsein und Lässigkeit wahrgenommen und repräsentiert wird. Aber Wunsch allein reicht nicht. Solange Lohnunterschiede, Vermögensverteilungen und politische Repräsentation sich entlang dieser alten Grenze sortieren, bleibt sie bestehen.
Deshalb müssen wir an den realen Defiziten arbeiten: durch gerechtere Strukturen, echte Aufstiegschancen und eine politische Kultur, die Vielfalt als Stärke begreift. Und wir sollten gemeinsam Perspektivwechsel ermöglichen, um langfristig Perspektivvielfalt und damit Stärke, Stabilität und Sicherheit in unsicheren Zeiten zu gewinnen.

Die MDR-Doku „Abgeschrieben? – Der Osten in den Medien“ für die ARD zeigt hartnäckige Klischees und Vorurteile. Abbildung: MDR
Christin Bohmann
GEBOREN: 1987/Gera Wohnort
WOHNORT (aktuell): Leipzig
MEIN BUCHTIPP: Hendrik Bolz: „Nullerjahre: Jugend in blühenden Landschaften“, 2022
MEIN DOKUTIPP: Es ist kompliziert… – Der Osten in den Medien, 2024
MEIN URLAUBSTIPP: Weinregion Saale-Unstrut erwandern
 BUCHTIPP: BUCHTIPP:
„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Auch dieser zweite Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die weiteren 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Band 2, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2025, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |