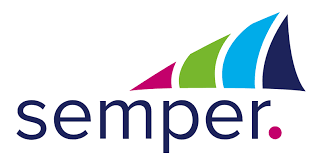Mario Czaja ist Bundestagsabgeordneter aus Ostberlin. Wir sprachen mit dem ehemaligen Generalsekretär der Bundes-CDU unter anderem über die Ostwahlen, eine Ostquote und das Amt des Ostbeauftragten.

Mario Czaja ist Bundestagsabgeordneter und ehrenamtlicher Präsident des Deutschen Roten Kreuzes Berlin. Von Januar 2022 bis Juli 2023 war er Generalsekretär der Bundes-CDU. Abbildung: Tobias Koch.
ostdeutschland.info: Herr Czaja, Ihr Buch „Wie der Osten Deutschland rettet“ ist im August dieses Jahres erschienen. Sind Sie auch nach den drei sogenannten Ostwahlen noch zufrieden mit dem Titel? Wie bewerten Sie die Wahlergebnisse?
Mario Czaja: Der Osten hat in den vergangenen 34 Jahren eine bemerkenswerte Stärke gezeigt, daran gibt es keinen Zweifel. Wir sind anpassungsfähig, wir sind mutig und wir sind entschlossen, von vorne zu beginnen und etwas Neues zu schaffen. Diese Kraft und Entschlossenheit sind heute wichtiger denn je. Die jüngsten Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg beweisen, dass die Stimmen aus dem Osten gehört werden müssen.
Sie waren ein „Weckruf“ für unsere Demokratie und haben erneut gezeigt, dass die Stimmen aus dem Osten ernst genommen werden müssen – und zwar ohne Wenn und Aber. Denn sie sind oft der Spiegel der gesellschaftlichen Lage, lange bevor sie anderswo wahrnehmbar werden. Der Osten ist ein Frühwarnsystem für ganz Deutschland.
Betrachtet man die Ergebnisse aller drei Wahlen, so lässt sich zweifelsfrei feststellen, dass die Ampel-Regierung unter Scholz, Habeck und Lindner den Kontakt zur Bevölkerung verloren hat. Sie regiert an den Bedürfnissen der Menschen vorbei und trifft fast durchweg Entscheidungen gegen die Mehrheitsauffassung der Deutschen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat das frühzeitig erkannt und handelt entsprechend. Der Sozialdemokrat hat seinen Schlussspurt-Wahlsieg mit größtmöglicher Distanz zum SPD-Bundeskanzler und mit größtmöglicher Distanz zur Bundespolitik der SPD-geführten Ampel erreicht.
Die aktuelle Stimmung im Land zeigt ganz deutlich, was zu tun ist: Die Parteien der Mitte müssen die Probleme in unserem Land lösen und den Menschen die Zukunftssorgen nehmen. Nur so verhindern wir, dass extremistische Kräfte das Ruder übernehmen und die Demokratie aushebeln. Der Skandal bei der konstituierenden Sitzung des Thüringer Landtags sollte uns allen Warnung und deutliche Mahnung zugleich sein.
In meinem Buch „Wie der Osten Deutschland rettet“ liefere ich auch Erklärungen für das Wahlverhalten der Bürgerinnen und Bürger im Osten und gehe auf die tief sitzenden Verletzungen infolge von Desinteresse des Westens am Osten ein. Der Titel passt daher aus meiner Sicht mehr denn je – und besser als je zuvor.
Wie erklären Sie sich, dass so viele junge Wähler die AfD gewählt haben?
Wir sehen bei den jüngsten Wahlen, dass die jüngere Generation eine noch größere Distanz zur Demokratie aufgebaut hat als die ältere. Das gilt für zahlreiche gesellschaftliche Debatten. Mich überrascht dies nicht. Die Jüngeren merken die Entwicklungen im Alltag stärker. Sie sehen die offenkundig nicht abnehmende Zuwanderung und merken natürlich, dass die Integration der zu uns gekommenen Menschen an vielen Stellen nicht gelingt. Das führt zu Veränderungen in allen Regionen und im täglichen Leben. Damit einhergehend wächst bei vielen dieser jungen Menschen die Sorge, dass die Lastenverteilung nicht mehr gerecht ist, und sie fragen sich mehr und mehr, ob für sie persönlich unter diesen Umständen künftig noch ein Leben in Freiheit und Sicherheit möglich sein wird. Die AfD thematisiert diese Sorgen auch in der digitalen Welt und übt so eine gewisse Anziehungskraft auf die Jungen aus.
Ein weiterer Aspekt, den wir nicht unterschätzen sollten, ist der, dass bei jungen Menschen und Ostdeutschen generell die Parteienbindung geringer ist. Daher sind Wechsel bei der Parteienpräferenz einfacher.

Mario Czaja ist in Berlin-Mahlsdorf aufgewachsen. Abbildung: Tobias Koch.
Sie gehören zu den wenigen, die auch konkrete Vorschläge zum Zusammenwachsen von Ost und West machen. In Ihrem Buch sprechen Sie sich zum Beispiel für ein Kinderstartkapital aus. Wie muss man sich das vorstellen?
Die Idee ist, dass jedes in Deutschland geborene Kind mit der Geburt einen Anteil von 10.000 Euro an einem Kapitalfonds erhält. Dieser Geldbetrag ist nicht bar auszahlbar. Damit kann das Kind dann aber ab dem 18. Lebensjahr ein Stipendium finanzieren, in eine Unternehmensgründung investieren oder sich eine langfristige Altersvorsorge aufbauen. Damit könnten wir die Akkumulation des Vermögens auf eine relativ kleine Personengruppe künftig aufbrechen.
Wie ließe sich das Kinderstartkapital finanzieren?
Finanzieren ließe sich dieses Modell ganz einfach über die Erbschaftssteuer. Sie könnte moderat angehoben werden oder ihre Ausnahmen müssten deutlich reduziert werden.
Einen weiteren Vorschlag nennen Sie „DIN Ost“. Was ist damit gemeint?
Der Osten hat viele Entwicklungen bereits Jahre zuvor durchlaufen, die nun trotz einer leichten demografischen Erholung unaufhaltsam ganz Deutschland erreichen. Wir benötigen einen Weckruf, um die Umbruchserfahrungen des Ostens im ganzen Land zu nutzen. Standards dürfen nicht in Stein gemeißelt sein. Auch dann nicht, wenn sie sich in Vorzeiten und unter bestimmten Bedingungen in den alten Bundesländern bewährt haben. Im Gegenteil: Standards sollten hinterfragt und an neue Gegebenheiten angepasst werden, im Osten wie im Westen. Denn überall befindet sich unsere Gesellschaft in einem tiefgreifenden demografischen Wandel. Die Bevölkerung wird immer älter. Die Abwanderung junger Menschen aus ländlichen Gebieten hält unvermindert an. Darauf muss eine Gesellschaft reagieren – mit reduzierten und somit kostensenkenden Standards bei Straßenbau und Kanalisation, mit der Bündelung von Ressourcen in medizinischen Versorgungszentren und einem Netz von Ganztagsschulen im ländlichen Raum.
Ich bin der Auffassung, dass es an der Zeit ist, im Bundesrat eine länderübergreifende Zusammenarbeit zu institutionalisieren, die diese Transformationserkenntnisse ernsthaft zusammenträgt und sie gleichzeitig auch als Blaupause für jene Regionen nutzt, die westlich der Elbe mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Auf diese Weise könnte, metaphorisch gesprochen, eine Art „DIN Ost“ entstehen, die Lösungen für ganz Deutschland bereithält.
50 Prozent der Spitzenpositionen in den ostdeutschen Landesministerien sollten von Ostdeutschen besetzt werden. Und 20 Prozent der zu besetzenden Stellen in Bundesministerien.“
Sie sind auch für eine Ostquote. Wie soll diese konkret aussehen?
50 Prozent der Spitzenpositionen in den ostdeutschen Landesministerien sollten von Ostdeutschen besetzt werden. Und 20 Prozent der zu besetzenden Stellen in Bundesministerien. Die Idee der Wendejahre, dass da für den Übergang ein paar westdeutsche Aufbauhelfer Führungspositionen übernehmen und die Ossis schon irgendwann nachrücken, ist gescheitert. In fast allen ostdeutschen Bundesländern besteht die Hälfte der jeweiligen Kabinette aus westdeutschen Ministern! Stellen Sie sich mal für einen Moment vor, in der bayerischen Staatsregierung würden zur Hälfte Sachsen, Berliner und Thüringer sitzen. Die CSU würde eine Sondersitzung nach der anderen einfordern. Ich könnte mir die Rhetorik von Alexander Dobrindt und seinen Freunden lebhaft ausmalen. Und ich könnte sie sogar verstehen!
Was wir brauchen, ist Chancengerechtigkeit. Die gibt es an vielen Stellen schlicht nicht. Das zeigt sich etwa bei der Vermögensverteilung. In Ostdeutschland gab es zum Zeitpunkt der Währungsunion nicht mal 100 Millionäre, während es im Westen zu diesem Zeitpunkt schon über 100 Milliardäre gab. Der Osten hatte also nie eine mit dem Westen vergleichbare materielle Infrastruktur. Menschen ohne Vermögen stoßen hierzulande oft an gläserne Decken, etwa wenn sie sich für ein Stipendium bewerben oder in die Selbstständigkeit wechseln wollen.
Auf den Vorschlag einer Ostquote folgt oft der Einwand, es lasse sich doch gar nicht mehr klar sagen, wer ostdeutsch sei. Wie stehen Sie dazu?
Ich kann dem Einwand, dass die Definition des Personenkreises, der unter den Begriff „ostdeutsch” fällt, die größte Hürde bei der Umsetzung einer solchen Quote darstellt, nur zustimmen. Bislang konnte man sich in den Debatten im Deutschen Bundestag noch nicht auf einen rechtssicheren Terminus einigen. Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, den Begriff „ostdeutsch” zu definieren. Dabei könnten sowohl der Wohnort, der Geburtsort, die familiäre Sozialisation als auch die emotionale Selbstidentifikation als Kriterien herangezogen werden. In meiner Buchpublikation orientiere ich mich an einer Kategorisierung, die sich am Geburtsort orientiert. Da Führungspositionen in der Regel in der Mitte der beruflichen Laufbahn erreicht werden, möchte ich vorsichtig die These aufstellen, dass eine Unterscheidung nach ost- und westdeutscher Herkunft, basierend auf dem Geburtsort, angemessen sein könnte. Darüber hinaus wird der Geburtsort zusammen mit dem Wohnort in der Personalstatistik erfasst, was diese Vorgehensweise auch praktikabel macht. Personen, die in den neuen Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen geboren wurden, gelten somit als Ostdeutsche. Berlin nimmt aufgrund seiner geteilten Geschichte eine besondere Position ein und muss daher separat betrachtet werden.
Ich finde, wir Ostdeutschen in der CDU sollten auch selbstbewusster mehr Repräsentanz einfordern. Vor allem müssen wir deutlich machen: Es braucht eine Quote für Ostdeutsche in unseren Führungsgremien.“
Wie weit ist eigentlich Ihre eigene Partei, die CDU, von der Quote entfernt, die Sie fordern? Wie viele Ostdeutsche könnte insbesondere die erste Reihe noch vertragen?
Bei der Besetzung von Spitzenpositionen mit Ostdeutschen ist meine Partei eher eine Nachzüglerin. Gewiss, Angela Merkel war zuerst Generalsekretärin und später dann viele Jahre Bundesvorsitzende der CDU. Ja, auch ich leitete für einige Zeit als Generalsekretär die Geschicke der Bundespartei aus der fünften Etage des Adenauer-Hauses in Berlin. Aber ansonsten ist die Luft in höheren CDU-Sphären für Ostdeutsche sehr dünn. Ein Beleg dafür liefert auch ein für mich persönlich sehr trauriges Ereignis: Als ich am 5. Januar 2024 an der Beerdigung von Wolfgang Schäuble in Offenburg teilnahm, der in unendlich vielen Funktionen und auch für den Wiedervereinigungsprozess bleibende Verdienste für Deutschland hat und der mir speziell in den letzten Jahren oft ein väterlicher Ratgeber war, war ich weit und breit der einzige Christdemokrat mit ostdeutschen Wurzeln, der an seinem Grab stand.
In den Gremien der Bundes-CDU ist die Repräsentanz der Ostdeutschen nach wie vor sehr gering. Das muss sich ändern. Nicht nur weil es darum geht, dass die Ostdeutschen das Anrecht haben sollten, mit am Tisch zu sitzen. Sondern weil Politik dann besser wird, da wir voneinander lernen können.
Ich finde, wir Ostdeutschen in der CDU sollten auch selbstbewusster mehr Repräsentanz einfordern. Vor allem müssen wir deutlich machen: Es braucht eine Quote für Ostdeutsche in unseren Führungsgremien. So etwas zu fordern ist kein Affront gegen die Satzung der Union. Im Gegenteil: Die Gründungsgeschichte der CDU ist ohne den Ausgleich zwischen unterschiedlichen Gruppen gar nicht denkbar. Den Vätern und Müttern der Union ist es gelungen, Protestanten und Katholiken, Nord- und Süddeutsche, Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenzubringen. Noch heute spürt man diese Wurzeln. Überall in der CDU gibt es Quotierungen, nur nicht zwischen Ost und West.

Zu Besuch beim Kinderprojekt Arche in Berlin-Hellersdorf. Abbildung: Tobias Koch.
Sie plädieren außerdem für Bürgerräte. Damit stehen Sie nicht allein. Zu den Befürwortern gehört zum Beispiel auch der Soziologe Steffen Mau. Wie können Bürgerräte helfen?
Die Politik muss mehr Mut zeigen, die Bürgerinnen und Bürger an den entscheidenden politischen Fragen zu beteiligen. Wir müssen wieder mehr mit den Menschen ins Gespräch kommen. Ich bin sehr dafür, über Bürgerbeiräte mehr Mitbestimmung vor Ort zu ermöglichen. Sie könnten zum Beispiel darüber entscheiden, wer zusätzliche Leistungen aus der Sozialhilfe bekommt, etwa für den altersgerechten Umbau der Wohnung eines bedürftigen Rentners aus dem Kiez.
Einzelne Instrumente der Partizipation nicht anzuwenden, weil man Angst vor der Meinung der Bevölkerung hat, halte ich für kurzsichtig. Wenn die Menschen nicht besser an Entscheidungen beteiligt werden, dann suchen sie sich früher oder später ein anderes Ventil für ihren Frust.
Was zählt für Sie zu den größten Fehlern der „Wiedervereinigung“ und ist das eigentlich der passende Begriff?
Rückblickend muss man nüchtern feststellen, dass die ostdeutschen Vertreter bei der Aushandlung des Einigungsvertrages nicht selbstbewusst und professionell genug waren, die Ansprüche der Ostdeutschen adäquat einzufordern und durchzusetzen. Das kann man sicherlich nicht den westdeutschen Unterhändlern anlasten.
Mehr als nur ein Makel war, dass die Eigentumsfragen – von der Bodenreform bis hin zum Eigentum an Häusern und Wohnungen – nicht richtig gelöst wurden und daher anschließend zulasten der Ostdeutschen gingen. Auf Basis des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes und des Altschuldengesetzes konnten sich viele Westdeutsche in Ostdeutschland bedienen.

Die Mühle von Alt-Marzahn ist ein Wahrzeichen des Bezirks, in dem Mario Czaja 2021 per Direktmandat in den Deutschen Bundestag einzog. Abbildung: Tobias Koch.
Die mangelnde Eigentumsbildung unter Ostdeutschen ist bis heute ein Problem. Die Vermögen sind deutlich geringer und nicht vergleichbar mit Vermögen in den alten Bundesländern. Dadurch ist auch die Kapitalkraft vieler ostdeutscher Unternehmen deutlich geringer. Der Mittelstand im Osten besteht zum Großteil aus Unternehmen mit einem bis oft maximal 30 Angestellten. In Westdeutschland zählen sich viele Unternehmen mit 2.000 Mitarbeitern zum Mittelstand. Die geringe Kapitalkraft macht den ostdeutschen Mittelstand zum einen deutlich krisenanfälliger und zum anderen schränkt das die Innovationskraft ein, weil viele Firmen keinerlei Ressourcen für eigenständige Forschung und Entwicklung haben.
Ein dritter Punkt ist sicherlich das in vielen Fällen unselige Wirken der Treuhandanstalt, die einen Ausverkauf der DDR-Industrie ohne Augenmaß betrieben hat.
Wie stehen Sie zu Vorschlägen wie dem zu einer neuen Verfassung und dem zu einer neuen Nationalhymne?
In Sachen Grundgesetz geht es wohl eher um einen emotionalen Ansatz, der dann aber vor 34 Jahren auf die Tagesordnung gehört hätte. Damals wäre eine stärkere ostdeutsche Handschrift wünschenswert gewesen, weil sie in der damaligen Situation das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen hätte stärken können.
Das Grundgesetz ist seit der Wiedervereinigung immer wieder erweitert und ergänzt worden, unter aktiver Mitwirkung auch ostdeutscher Parlamentarier. Rational sehe ich im Moment beim Grundgesetz keine Inhalte, die mit Blick auf den Osten gesondert geregelt werden müssten.
Und bei der Nationalhymne empfehle ich, die Stimmung in den Stadien bei der jüngsten Fußball-Europameisterschaft Revue passieren zu lassen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Fans bei den Spielen des deutschen Teams mit der Nationalhymne gefremdelt haben.
Glauben Sie, dass es unter der nächsten Bundesregierung noch einen Ostbeauftragten geben wird?
Ganz klar – ja. Allerdings halte ich es da mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer: Der ideale Ostbeauftragte wäre der Bundesminister für Bildung und Forschung. Denn nur, wenn mehr und konsequenter als bislang gezielt Forschungsmittel in den Osten gehen, wird der ostdeutsche Aufholprozess Erfolg haben. Es ist wichtig, dass auch in Zukunft am Kabinettstisch jemand sitzt, der darauf achtet, dass der Osten nicht zu kurz kommt. Aus meiner Zeit als Generalsekretär der Bundes-CDU weiß ich nur zu gut, dass Ostdeutschland für viele Menschen in den alten Bundesländern bis heute noch unbekanntes Terrain ist.
Vielen Dank.
Die Fragen stellte Robert Nehring.
| BUCHTIPP:
Mario Czaja: „Wie der Osten Deutschland rettet: Lösungen für ein neues Miteinander“*, Verlag Herder 2024, 192 S., 20,00 €. |