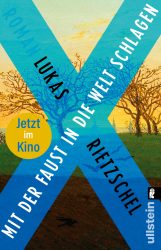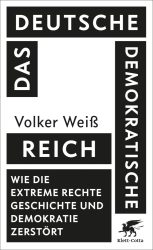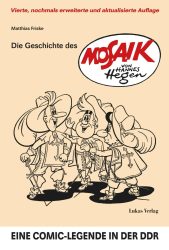Dr. Mandy Tröger, Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Tübingen, ist eine wichtige Impulsgeberin für Ostdeutschland. Sie setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist sie auch in dem Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.

Dr. Mandy Tröger, Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin, Universität Tübingen. Abbildung: M. Tröger
Denke ich an Ostdeutschland, denke ich an eine Fülle wertvoller Erfahrungen. Schon mit Anfang zwanzig habe ich zwei Währungsreformen, den Fall der Berliner Mauer, den Zusammenbruch eines Staates und die Transformation von einem Gesellschaftssystem in ein anderes erlebt. Aufgrund dieser Erfahrungen sehe ich manches anders; vieles würde ich sonst womöglich gar nicht sehen, und ich bin nur ein Beispiel unter vielen. Weltgeschichte passierte quasi vor unserer Haustür. Diese Erfahrungen sind ein Schatz und sollten auch als solcher gesehen werden, anstatt aus der Geschichte zu fallen. Dafür arbeite ich als Wissenschaftlerin und Journalistin:
- Als Wissenschaftlerin erforsche ich ostdeutsche Medien- und Transformationsgeschichte und versuche, sie für aktuelle gesellschaftliche Debatten nutzbar zu machen. Grundsätzlich braucht es mehr ostdeutsche Professorinnen und Professoren in der Wissenschaft!
- Als Journalistin versuche ich, Perspektiven sichtbar zu machen, die sich aus ostdeutschen Erfahrungen ergeben. Es braucht mehr ostdeutsche Stimmen in den Medien!
Ich bin dankbar, dass ich diese Arbeit machen kann. Denn mein Ziel, wissenschaftliche und öffentliche Debatten zu erweitern, hängt eng mit meiner Biografie zusammen. Ich habe von der Wende profitiert; ich konnte im Ausland arbeiten und studieren. Trotzdem ist es wichtig und legitim, kritisch auf die Einheit zu sehen, also auf das, was möglich gewesen wäre, und das, was für viele Menschen daraus geworden ist – in Ost und West. Denn es gibt vieles, was wir aus dieser Geschichte lernen und mitnehmen können. Auch dank meiner Ostberliner Herkunft sehe ich vor allem das Potenzial ostdeutscher Geschichte; es wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Trotzdem war der Weg hierher nicht leicht und ist es bis heute nicht.
Es braucht mehr ostdeutsche Professorinnen und Professoren in der Wissenschaft! [...] Es braucht mehr ostdeutsche Stimmen in den Medien!”
Damals und heute
Ich bin am Rosa-Luxemburg-Platz in Prenzlauer Berg aufgewachsen. Meine Mutter war alleinerziehend, unpolitisch und arbeitete zu DDR-Zeiten als Bürokraft gegenüber dem Checkpoint Charlie. Als ich später Austauschschülerin in den USA war, kannte man die DDR dort kaum, aber der Grenzübergang Checkpoint Charlie war ein Begriff.
Meine Kindheit in der DDR war normal. Dass wir neben der Mauer lebten, hinterfragte ich gar nicht. Das kam später. Meine Kinderkrippe fand ich super, auch meinen Kindergarten. In der Schule habe ich es noch bis zu den Thälmann-Pionieren geschafft. Dann kamen die Massenproteste im Herbst 1989, und wir waren mittendrin.
Selbst als Kind wusste ich, dass hier etwas Großes passierte. Es geschah so viel auf einmal, dass ich Tagebuch schrieb. Ich wollte später einmal erzählen können, was genau geschah – sollte jemand fragen. Bis heute bin ich dankbar, dass das zu meinen ersten Kindheitserfahrungen zählt.
Kurz darauf fiel die Mauer, und am nächsten Tag fuhr meine Familie nach Westberlin. Die Atmosphäre war unglaublich. Fremde Menschen umarmten mich mit Tränen in den Augen, schenkten mir Schokolade, und ich sah den ersten obdachlosen Menschen in meinem Leben. Damals begriff ich nicht, wie es sein konnte, dass an einem Ort, an dem alles glänzte, manche Menschen kein Zuhause hatten. Ich gab dem Obdachlosen mein ganzes Taschengeld. Heute laufe ich selbst an obdachlosen Menschen vorbei und tue so, als sei das normal. Gleichzeitig versuche ich, meine Erinnerung an den ersten Schock wachzuhalten. Denn ehrlich, wir sollten alle schockiert sein.
Dann kam die Wende- und später die Nachwendezeit. Die waren hart. Meine Mutter war ständig auf der Arbeit. Sie hatte Angst, ihren Job und unsere Wohnung zu verlieren. Meinen Schulfreunden ging es ähnlich. Unsere Eltern waren mit sich beschäftigt, und in der Schule änderte sich alles. Galt zu DDR-Zeiten etwas als richtig, galt das nun als falsch. So lernte ich schon in der 5. Klasse, dass Geschichte konstruiert ist – „richtig“ und „falsch“ gibt es selten. Das war eine wertvolle Erfahrung.
Wissenschaft? Nie!
Heute bin ich Historikerin und schreibe selbst Geschichte. Ich erforsche die DDR-Medientransformation. Das heißt, ich untersuche, welche politischen und wirtschaftlichen Interessen den Umbruch der DDR-Medien mitbestimmten. Dafür arbeite ich in Archiven auf der ganzen Welt, beispielsweise im Archiv des Wendemuseums in Los Angeles oder im Internationalen Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam. Aktuell erforsche ich die Handlungsrahmen der Treuhand in der Privatisierung der DDR-Presse. Das heißt, ich arbeite mich durch Aktenberge der Treuhandanstalt und versuche zu rekonstruieren, was damals passierte. Oft muss ich Dinge, die ich seit meiner Jugend über die Treuhand gehört habe, hinterfragen.
Letztlich sind die Folgen der DDR-Zeitungsprivatisierungen bis heute spürbar: Die ostdeutsche Regionalpresse ist in der Hand westdeutscher Verlage. Es gibt kein nennenswertes überregionales ostdeutsches Nachrichtenmedium und in den Chefredaktionen deutscher Medien sitzen kaum Menschen mit ostdeutschem Hintergrund. Diese Lücken haben Auswirkungen auf die mediale Darstellung Ostdeutschlands, beispielsweise wird „der Osten“ gern als eine Region beschrieben, regionale Vielfalt und Unterschiede bleiben aus. Auch dank meiner Herkunft sehe ich diese Unterschiede und dementsprechend die medialen Lücken. Die Forschung zu diesen Themen versuche ich in öffentlichen Vorträgen und Interviews zu vermitteln.
Witzigerweise wollte ich nie in die Wissenschaft. In der Schule schwänzte ich viel, schaffte mein Abi kaum und wollte nur weg: Ich war Austauschschülerin in den USA, jobbte nach dem Abi zwei Jahre im Ausland, unter anderem mit obdachlosen Jugendlichen aus New York City. Damals war es schwierig, diese Umwege zu rechtfertigen, heute bin ich dankbar für diese Zeit. Ich hatte die Möglichkeiten, mich auszuprobieren und habe viel gelernt. Diesen Freiraum hatte ich auch dank der Nachwendezeit. Viele Jugendliche mussten früh ihre eigenen Wege finden.
Das Geschichtsstudium in Erfurt begann ich dann dank Bafög. Ich wusste nicht wirklich, was Studieren bedeutet, aber das Studium veränderte mein Leben. Ich sah, wie Bildung auch sein kann: kritisch, emanzipiert, differenziert. Viele Fragen, die ich mich umtrieben, konnte ich im Studium bearbeiten. Heute versuche ich, dieses Interesse meinen Studierenden zu vermitteln und wünschte mir oft, sie hätten mehr Freiräume, sich auszuprobieren.
Für die Promotion in die USA
Für meinen Master ging ich (dank Auslands-Bafög) nach Amsterdam und arbeitete dort einige Zeit als Nachrichtenredakteurin. So fing ich an, mich für die kritische Analyse von Medien zu interessieren und bewarb mich dann für ein Doktorstudium (inklusive finanzieller Förderung) an der Universität Illinois. Dort arbeiteten viele Professorinnen und Professoren in der marxschen Tradition der kritischen politischen Ökonomie. Das heißt, sie erforschten Medienmärkte, Informationsmonopole und Wirtschaftsinteressen im Nachrichtengeschäft. Kurz: Illinois war der perfekte Ort, um die DDR-Medienwende kritisch zu erforschen. In Deutschland ist das Thema bis heute zu nah an weiterhin existierenden politischen und wirtschaftlichen Interessen. Es wirkte paradox: Ich komme aus Ostberlin und lande in den USA bei Karl Marx. Diesen Weg konnte ich letztlich auch nur dank staatlicher Förderung des deutschen Hochschulsystems gehen. Wäre ich in den USA aufgewachsen, hätte ich wohl nie promoviert.
Für die Menschen in den USA war meine ostdeutsche Herkunft faszinierend. Sie stellten mir Fragen über Ostberlin, den Fall der Mauer, die Wende – in Westdeutschland hat mich danach bisher kaum jemand gefragt. An der Universität Illinois war meine Forschung zur DDR-Medientransformation also ein spannendes Fallbeispiel. Für die Ostdeutschen, die ich für meine Doktorarbeit interviewte, war es ihr Leben. Die Wendezeit war oft verbunden mit traumatischen Erfahrungen und Desillusionen. Denn zur Wende hatten sie viele Ideen gehabt, wie eine freie Presse auch funktionieren kann, und versucht, diese umzusetzen. Oft ging ihr Einsatz unter. Vielen fiel es schwer, von diesen Erfahrungen zu erzählen. Manche taten es, weil auch ich ostdeutsch war. Das war ein Privileg.
Letztlich lebte ich sieben Jahre in den USA – erst in Illinois, dann in Arizona. In dieser Zeit traf ich immer wieder auf Frauen aus Ostdeutschland, mit denen ich mich auf Anhieb verstand – eine Freundin war noch zu DDR-Zeiten im Kofferraum eines Autos geflüchtet. Trotz unseres Altersunterschieds verband uns unsere ostdeutsche Herkunft und unser Selbstverständnis als Frau. Denn als Kind einer alleinerziehenden Ostberliner Mutter war für mich immer klar: Frauen meistern ihr Leben selbstbestimmt.
Letztlich traf ich in den USA einen Mann, der das genauso sieht. Wir sind seit sechs Jahren verheiratet; heute bezeichnet er sich gern als „Ossi“. Für ihn bedeutet das vor allem Kreativität und Durchhaltevermögen. Er ist dankbar, dass er ostdeutsche Geschichte durch meine Familie und Freunde erfahren darf.
Zurück in (West)Deutschland
Nach insgesamt zwölf Jahren im Ausland kamen mein Mann und ich 2018 nach Deutschland zurück. Ich wollte mit meiner Forschung einen Beitrag zu gesellschaftlichen Debatten leisten. Bisher habe ich an Universitäten in München, Hannover und Tübingen gearbeitet. Nicht selten bin ich die einzige (ostdeutsche) Frau unter vielen (westdeutschen) Männern. Zusätzlich komme ich aus einem bildungsfernen Ein-Elternhaus; auch das ist in der Wissenschaft die Ausnahme.
Ich bin dankbar für diese Herkunft. Durch sie weiß ich, dass die akademische Blase, die mich oft umgibt, nur ein Ausschnitt aus einer breiteren Gesellschaft ist. Viele Menschen haben andere Leben, einen anderen Alltag und andere Probleme. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten hierfür mehr Bewusstsein entwickeln und ihre eigenen blinden Flecken hinterfragen. Das bezieht sich auch auf die vielen Ideen und Initiativen, die Menschen aus den verschiedenen Regionen Ostdeutschlands in gesellschaftliche Debatten einbringen können. Denn nicht selten schöpfen sie aus einem Erfahrungsschatz, der seinesgleichen sucht.
Dr. Mandy Tröger
GEBOREN: 1980/Ostberlin
WOHNORTE (aktuell): London, Berlin
MEIN BUCHTIPP: Thomas Ahbe, Rainer Gries, Wolfgang Schmale (Hgg.): „Die Ostdeutschen in den Medien. Das Bild von den Anderen nach 1990“, 2009
MEIN FILMTIPP: „Die Kinder von Golzow“, 1961–2007
MEIN URLAUBSTIPP: Oder-Neisse-Radweg
 BUCHTIPP: BUCHTIPP:
„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Dieser Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2024, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |




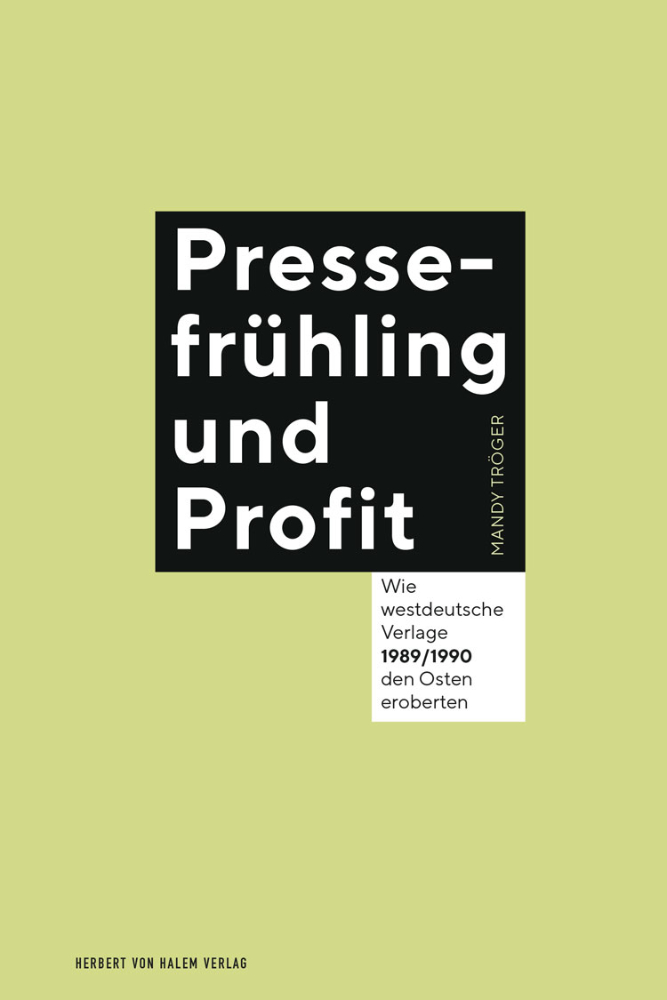


 Dr. Mandy Tröger stand auch der SuperIllu Rede und Antwort. Abbildungen: SuperIllu
Dr. Mandy Tröger stand auch der SuperIllu Rede und Antwort. Abbildungen: SuperIllu