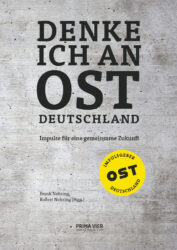Der Journalist Gabor Halasz ist ein wichtiger Impulsgeber für Ostdeutschland. Er setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist er auch in dem Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.
Denke ich an Ostdeutschland, dann denke ich an Hoffnung. Daran, dass Mauern fallen können. Auch wenn sie mit Stacheldraht und Todesstreifen geschützt sind – also unüberwindbar scheinen. Ich denke daran, dass nichts so bleiben muss, wie es ist. Dass auch finstere Diktaturen stürzen können. Dass am Ende Freiheit und Demokratie gewinnen. Ja, das mag ein wenig kitschig oder auch naiv klingen und lässt sich deswegen auch leicht abtun. Aber erinnern wir uns doch an das Jahr 1989. Wer hätte noch im Frühling gedacht, dass bald die Mauer fällt? Alles ist möglich – das kann ein tröstlicher Gedanke sein.
Er könnte uns helfen, gerade in den heutigen Zeiten. Die Gewissheit, dass sich Dinge ändern können – auch grundlegend –, das ist eine Quelle für Hoffnung und Optimismus. Hoffnung, dass Kriege beendet werden und Frieden herrscht. Das Denken an die friedliche Revolution von 1989 zeigt: Aufgeben und sich abfinden ist nie eine gute Idee.
Wie schön wäre es doch, wenn wir gegenseitig voneinander lernen und wenn unser Land ostdeutscher werden würde?”
Als alles möglich schien
1989 bis 1990. Es war eine verrückte Zeit. Ich habe sie in meiner Heimatstadt Leipzig erlebt. Dort wurde ich 1977 geboren, in dieser grauen Stadt, in der es im Winter nach Kohleofen roch. Ich lebte eine Kindheit, in der es Pioniernachmittage, aber auch abends die Tagesschau im Fernsehen gab. Ich glaubte an ein Land, doch selbst für mich als Zwölfjährigen waren Widersprüche spürbar. Woche für Woche gingen mehr Menschen auf die Straßen. Immer montags in Leipzig. Und dann kam der 9. Oktober 1989 – der Montag, als Zehntausende in Leipzig ihr Leben riskierten, weil sie für die Freiheit demonstrierten. Ich hatte Angst, denn ich konnte mich gut an die Bilder aus Peking erinnern – Bilder, die auch die DDR erreicht hatten. Sie zeigten Panzer auf dem Tiananmen-Platz. Das war gerade mal ein halbes Jahr her. Passiert so ein Massaker jetzt auch in Leipzig? In meiner Heimatstadt? Unser Lehrer warnte uns an diesem Montag, wir sollten nicht in die Innenstadt gehen. Am Ende kamen 70.000 Menschen, es wurde nicht geschossen und es war der Schlüsselmoment dieses Herbstes. Revolutionen funktionieren auch friedlich, die Ostdeutschen haben das an diesem Montagabend in Leipzig – aber auch in vielen anderen Städten zuvor – bewiesen. Es waren die glücklichsten Wochen der deutschen Geschichte. Als plötzlich alles möglich schien.
Es folgte der Mauerfall, die erste Fahrt nach Westberlin. Ich fand diese Stimmung damals ganz wunderbar und ich meine weit mehr als den Geruch der Kaufhäuser am Kurfürstendamm. Es war dieser neue Geist, die Aufbruchstimmung, die Möglichkeiten der Demokratie. Ich erinnere mich, dass damals die Sitzungen des Runden Tisches im Fernsehen liefen. Mühsame Politik live gesendet. Dort am Runden Tisch wurde sogar ein Verfassungsentwurf für die DDR erarbeitet. Es konnte sogar passieren, dass sich Menschen aus völlig unterschiedlichen Parteien gegenseitig überzeugten. Einfach aus der Kraft des Argumentes. Ich mag den Gedanken und würde ihn mir heute für manche Bundestagsdebatte wünschen, in der Fraktionszwang herrscht.
Dass das zu verträumt für die Realität ist, zeigte sich schnell: Spätestens am 18. März 1990 – als die Bürgerrechtler, die in meinen Augen die friedliche Revolution möglich gemacht haben, bei den ersten freien Wahlen der DDR kaum eine Rolle mehr spielten. Die Menschen wollten Reisefreiheit, West-Joghurt und natürlich die D-Mark. Der Verfassungsentwurf vom Runden Tisch landete im Papierkorb. Die DDR trat dem Grundgesetz bei. Heißt, im Westen änderte sich nichts – außer später die Postleitzahlen. Im Osten änderte sich alles. Ich hätte mir gewünscht, dass beide Seiten gemeinsam etwas Neues erarbeiten und das gute Grundgesetz mit Vorschlägen der DDR-Opposition noch besser gemacht hätten.
Eine neue, gemeinsame Hymne wäre zum Beispiel eine Idee gewesen. Dann hätten beide Seiten etwas Neues lernen müssen und es hätte eine Einheitserzählung gegeben.
Daraus ist viel Frust gewachsen, auch Frust mit der Demokratie. Sie ist nicht mehr aufregend wie 1989/90. Sie ist anstrengend, manchmal unverständlich und frustrierend. Aber doch das Beste, was wir haben. Und sie lebt wie damals von denen, die sich engagieren. Manchmal ärgere ich mich über eine Haltung, die es nicht nur im Osten gibt. Eine Haltung, die sich salopp so zusammenfassen lässt: Ich zahle doch Steuern, also muss der Staat auch liefern. Als wäre die Demokratie ein Lieferdienst. Nur so funktioniert sie eben nicht. Man darf auch mitmachen.
Vom Osten lernen
Es folgten die für mich sehr prägenden 90er-Jahre. Als die Generation meiner Eltern plötzlich fast alles verlor, was sie ausgemacht hat. Arbeit, Identität, Anerkennung. Was für eine Leistung ist es doch, dass sich Millionen Ostdeutsche zurückgekämpft haben. Dass sie wissen, was es bedeutet, wenn sich von einem Tag auf den anderen alles ändert. Neu starten, sich neu erfinden, etwas neu aufbauen. Das können die Ostdeutschen. Nur interessiert das heute meist kaum. Da wird in Berlin ein neues Heizungsgesetz geschrieben. Aber auf die Idee, mal im Osten nachzufragen, dort wo sich Menschen mit Transformationen auskennen, ist niemand gekommen. Eine verpasste Chance.
Ja, warum fragen wir uns eigentlich so wenig? Die Einheit vollenden bedeutet in meinen Augen für viele immer wieder: Alle sind gleich – Biografien gleichen sich an. Das möchte ich gar nicht, denn das wäre wahnsinnig langweilig. Ist es nicht vielmehr ein großes Geschenk, dass wir unterschiedlich sind? Wir müssen uns nur zuhören und neugierig aufeinander sein. Das gilt nicht nur für die Unterschiede zwischen Ost und West. Auch Menschen, die keine deutschen Wurzeln haben, bringen andere Perspektiven mit ein. Das macht uns am Ende reicher.
Doch noch immer ist unser Land sehr westdeutsch geprägt. Auch wenn wir eine ostdeutsche Kanzlerin und einen ostdeutschen Bundespräsidenten hatten, braucht es in der Spitzenpolitik eine Lupe, um Ostdeutsche zu finden. Sie fehlten zuletzt sogar auf den Gruppenfotos zum Tag der Deutschen Einheit und das Schlimme ist: Es fällt kaum jemandem auf. Wenn CDU-Chef Friedrich Merz im Bundestag die Wirtschaftsminister der 90er-Jahre lobt, dann merkt er offenbar gar nicht, was diese Zeit für die Menschen im Osten bedeutet hat. Sie erinnern sich sicher nicht an eine wirtschaftlich erfolgreiche Zeit. Oder: Die Coronapandemie wurde als schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Für viele Ostdeutsche entspricht das sicher nicht der Lebensrealität. Das alles zeigt, wie sehr ostdeutsche Perspektiven fehlen.
Ostdeutsche in Führungspositionen sind fast 35 Jahre nach der Wiedervereinigung noch immer unterrepräsentiert. Das Rentenniveau wurde erst kürzlich angeglichen. Noch immer wird deutlich weniger verdient und auch deutlich weniger vererbt. Das alles sind Gründe, warum sich die Benachteiligung auch nicht auswächst. Selbst die Ostdeutschen, die nach 1990 geboren wurden, fühlen sich nicht als Bürgerinnen und Bürger erster Klasse, obwohl sie die DDR nur aus Erzählungen kennen.
Neue Gräben
Ich möchte nicht von neuen Mauern sprechen, aber vielleicht von Gräben. Die haben sich durchaus wieder vertieft. Und daran sind dann auch durchaus beide Seiten schuld. Es geht schon mit der Frage los: Was ist das überhaupt – ostdeutsch sein? Muss ich im Osten geboren sein? Muss ich dort leben oder verliere ich den Ossi-Status, wenn ich weggezogen bin? Was ist mit Leuten, die im Westen geboren wurden und seit vielen Jahren im Osten leben? Oder eben mit denen, die erst nach 1990 geboren wurden? Es ist wahnsinnig kompliziert, aber ich finde, wir sollten es uns nicht so kompliziert machen.
Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass es DEN Osten so gar nicht gibt. Schlagzeilen wie „Der Osten hat gewählt“ sind keine Seltenheit. Einen derart undifferenzierten Blick auf den Westen gibt es nicht. Berichte wirkten lange, als wären sie von Auslandskorrespondenten verfasst. Reporter aus Hamburg oder Köln reisten an und brachten eine Geschichte im Kopf schon mit. Über den Ossi, den es so gar nicht gibt. Denn wer im Erzgebirge lebt, hat ganz andere Sorgen als in Berlin. Zwischen Schwerin und Suhl können Welten liegen. Um das zu ändern, braucht es nicht nur gute Reporterinnen und Reporter aus dem Osten. Es braucht starke und selbstbewusste ostdeutsche Medienhäuser und Sender.
Wir müssen uns nicht verstecken
Ja, DEN Ossi gibt es nicht. Aber es gibt etwas Verbindendes. Eine ostdeutsche Identität. Die Welt vor Ort ist nicht schwarz-weiß. Wie schön wäre es doch, wenn wir gegenseitig voneinander lernen und wenn unser Land ostdeutscher werden würde? Gemeint ist die Erfahrung, die die Ostdeutschen eingebracht haben, die aber irgendwo vergraben liegt. Vergraben wie auch das Selbstbewusstsein, dass uns Ostdeutschen manchmal durchaus gut zu Gesicht stehen würde. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben eine Menge zu erzählen und einzubringen. Vor allem können wir helfen, den Optimismus nicht zu verlieren.
Ich selbst habe mein Ostdeutschsein auch erst wiederentdeckt. Ich bin irgendwann aus meiner Heimatstadt weggezogen. Erst nach Hamburg, dann lebte ich fünf Jahre in Neu-Delhi. Von Indien aus wirken viele deutsche Debatten sehr weit weg – als ich aber dann zurückkehrte, merkte ich schnell, dass wir immer noch so sehr nebeneinanderher leben. Dass wir uns zu wenig zuhören. Nicht voneinander lernen. Wie schade! Ich selbst fühle mich immer wieder zwischen den Stühlen. Im Westen erkläre ich den Osten und im Osten den Westen. Einfach nur, weil ich in beiden Teilen gelebt und gearbeitet habe. Aber vielleicht ist so eine Position zwischen den Stühlen nicht die schlechteste. Sie hilft dabei, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen.
Eine ganz wichtige ist für mich die der friedlichen Revolution. Deswegen finde ich: Lasst uns mehr 1989 wagen. Ich wünsche mir etwas von diesem Geist zurück, von dieser Aufbruchstimmung. Ich wünsche mir Hoffnung und Optimismus.
Gabor Halasz
GEBOREN: 1977/Leipzig
WOHNORT: Berlin
MEINE BUCHTIPPS: Brigitte Reimann: „Franziska Linkerhand“, 1974; Clemens Meyer: „Als wir träumten“, 2006
MEIN FILMTIPP: „Wir Ostdeutsche – 30 Jahre im vereinten Land“, 2022
MEINE URLAUBSTIPPS: Dessau (Meisterhäuser), Darss, Weimar, Leipzig
 BUCHTIPP: BUCHTIPP:
„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Dieser Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2024, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |