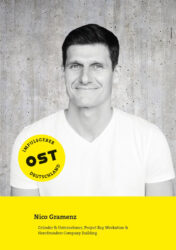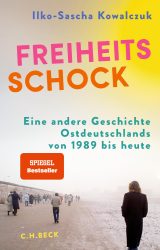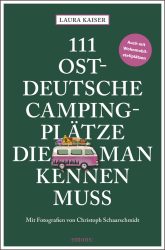Ina Remmers, die Gründerin von nebenan.de, ist eine wichtige Impulsgeberin für Ostdeutschland. Sie setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist sie auch in dem Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.
Denke ich an Ostdeutschland, denke ich an die vielen Geschichten und Schicksale meiner Elterngeneration. Stellvertretend lasse ich hier die von sehr guten Freunden der Familie einfließen. Ich nenne sie Ulrike und Siegfried. Gemeinsam fuhren die Familien in den Camping-Urlaub. Die Kinder waren gleichalt. Die Väter spielten zusammen Fußball, Skat und halfen sich beim Hausbau. Ulrike und Siegfried waren zum Zeitpunkt der Wende Meister ihres Fachs: Ulrike in der ortsansässigen Schuhfabrik, Siegfried in der Elektrotechnik. Beide waren gerade einmal Anfang 40 – so alt wie ich jetzt –, als die Mauer fiel und sich damit ihr gesamtes Leben auf den Kopf stellte. Zum Besseren, wie sie und weitere 16,4 Millionen Ostdeutsche hofften. In den Nachwendejahren erlebten beide jedoch zunächst auf unterschiedliche Weise nicht nur einen finanziellen Niedergang, sondern vor allem harte Schläge gegen ihr Selbstvertrauen.
Der Ostdeutsche ist für mich vor allem Sinnbild und Symbol gewisser Charaktereigenschaften, die zu selten gesehen werden.”
Harte Brüche und ein Neuanfang
Als der Betrieb von Ulrike Mitte der 90er seine Pforten schloss – Ulrike hat quasi den Schlüssel umgedreht und bis zuletzt gehofft, dass es irgendwie weitergeht –, war sie bereits Mitte 40. Zu dieser Zeit galt sie nach Aussagen des Arbeitsamts als ungeeignet und zu alt für den Arbeitsmarkt. Man muss sich das heute vorstellen: Ihr wurde noch nicht einmal eine Umschulung oder Weiterbildung finanziert. Ob in Überforderung der zu bewältigenden Anträge, mag ich nicht beurteilen. Ich beschreibe, was war. Das Arbeitsamt bezahlte jedoch Praktika, also absolvierte Ulrike mehrere davon. Schließlich hatte sie ihr ganzes Leben gearbeitet. Rumsitzen kam nicht infrage. Obwohl sie in den Betrieben immer durch ihre herzliche und engagierte Art hervorstach, wurde sie nicht übernommen. Während die Praktika gefördert wurden, konnte und wollte anschließend kein Unternehmen die tatsächlichen Kosten für sie übernehmen. Am Ende ihrer beruflichen Laufbahn stehen mehrere Aktenordner voller Bewerbungen und mehrere Sommer an der Kasse des örtlichen Freibads – einfach auf der Suche nach einer Aufgabe, nach Selbstwertgefühl.
Siegfried hingegen fand recht schnell einen Job. Elektriker sind ja auch heute noch gefragt – mehr denn je sogar. Also gab er alles. Er arbeitete mit größter Arbeitsmoral bis hin zur Selbstaufgabe. Wochenlange Montageeinsätze im Westen des Landes für ein Gehalt, das diesen Namen kaum verdient. Die Ausbeutung ging so weit, dass er sogar für Sprit und Unterkunft in Vorleistung gehen sollte. Mit zwei Kindern und einer arbeitsuchenden Frau zu Hause zog er schließlich die Reißleine. Erst Jahre später drehte sich das Blatt – oder man möchte sagen: der Markt. Siegfried ist mittlerweile Mitte 70 und wird heute noch angefragt, ob er nicht aushelfen könne. Für Ulrike hingegen gab es nie einen Weg zurück in die Arbeitswelt.
Die Wende hat das Leben meiner Familie und das von rund 16 Millionen Einwohnern der DDR für immer verändert. Mein Vater machte sich direkt auf nach Baden-Württemberg und kam nur noch am Wochenende nach Hause. Als Textilingenieure waren meine Eltern – zu unserem Glück – auch nach der Wende gefragt. Einige Monate später folgte unsere innerdeutsche Migrationserfahrung: der Umzug auf die Schwäbische Alb. Ein Kulturschock. Eine fremde Sprache – alle Schwaben werden mir zustimmen, dass Schwäbisch mehr als nur ein Dialekt ist. Völlige Überforderung im Supermarkt. Ich, ich, ich – schon in der Schule. Die große Bedeutung des Äußeren. Teilweise extreme Vorurteile. Für mich als Grundschulkind war das schwer. Von meinen Eltern ganz zu schweigen. Hinzu kamen die sehr eingeschränkten finanziellen Mittel. Meine Eltern begannen mit 40 noch einmal ganz von vorn. Da gab es kein Sparkonto, kein Aktiendepot und keine Eltern, die mal eben hätten unter die Arme greifen können.
Trotz all dieser Herausforderungen war es vor allem die Chance, noch einmal neu anzufangen: Karriere, Freundschaften, Reisen – Selbstverwirklichung. Das ist unsere Geschichte. Für viele andere Ostdeutsche sah, wie bereits beschrieben, die Nach-Wende-Realität jedoch ganz anders aus. Millionen von Geschichten sind nicht so verlaufen und werden viel zu wenig erzählt. Diesen Menschen widme ich dieses Kapitel: einer Generation, die mit 30, 40, 50 – mitten im Leben – von einem Tag auf den anderen ihre Existenz verlor und jahrelang, teilweise nie wieder, einen Job gefunden hat. Gut ausgebildete Leute, die plötzlich nur noch irgendwo an der Kasse jobben konnten – ohne Rücklagen.
Ostdeutsche sind gut für die Firmenkultur
Als Gründerin und Geschäftsführerin von nebenan.de habe ich immer unheimlich gern mit Menschen aus dem Osten zusammengearbeitet. Sie haben unserer Firmenkultur einfach gutgetan. Menschen mit Ost-Hintergrund erkenne ich von weitem, selbst wenn sie keinen Dialekt sprechen. Da war die Kollegin, die immer lauter war als andere – nicht, weil sie auf sich aufmerksam machen wollte, sondern weil sie lebensfroh und lustig war und sich einfach weigerte, eine glatte Professionalität an den Tag zu legen. Oder der Kollege, der mit seinen Ideen im Zweifelsfall fünfmal zu uns kam – weil er auf eine beinahe rührend-naive Art zutiefst davon überzeugt war, dass sie gut für das Unternehmen seien. Auch ihm fehlte das kühl Kalkulierende, was ich bei manchen Wessis wahrnehme.
Umgekehrt gibt es Verhaltensweisen, die ich eher mit Wessis assoziiere, jedenfalls mit einer bestimmten Art von Wessi: sehr von sich überzeugt, gleich mal eine Welle machen, wenn man den Raum betritt, statt erst mal zuzuhören, taktierend. Leute, die denken, dass sie das Rad neu erfinden können – und wenn es nicht klappt, sind die anderen schuld. Ich glaube tatsächlich, dass die Ossi-Art (die selbstverständlich auch manche Wessis teilen) gut und vor allem nachhaltig fürs Geschäft ist. Ich schätze es sehr, wenn man auch beruflich unverstellt und menschlich miteinander umgeht. Gute Geschäfte und eine gute Zusammenarbeit entstehen nur, wenn man versteht, wie der andere tickt, und den Menschen dahinter erkennt, sodass man eine Beziehung zueinander aufbauen kann. Alles andere empfinde ich als Rumgeeiere. Ich denke einfach, es würde uns allen guttun, wenn wir häufiger etwas direkter und empathischer miteinander umgehen würden – ohne eigene, selbst optimierende Agenda im Hinterkopf. Unsere Gesellschaft braucht das. Jetzt.
Warum sind viele Ossis direkter? Ich denke, das hat auch mit dem Thema Elite zu tun. Ich nehme dieses Direkte und Offene auch bei manchen Wessis wahr, und zwar häufiger bei Menschen, die nicht aus Akademiker-, sondern aus Arbeiter-Haushalten kommen. Wir haben die Eliten-Sprache und den Eliten-Habitus einfach nicht gelernt. Wir waren nicht von klein auf Teil einer gesellschaftlichen Elite, die von Anfang an, wenn auch nur indirekt, gelernt haben, dass sie der Nabel der Welt sind. Wer das seine ganze Kindheit und Jugend gespiegelt bekommt, geht auch mit einer gewissen Haltung in den Beruf: smooth, glänzend, relativ unbescheiden. Bei den Ossis gab es keine Weitergabe eines solchen Habitus. Die alte Elite ist ja (zum Glück) zerbrochen.
Im Osten war man gegenüber Vorgesetzten schweigsam und vorsichtig – im Privaten, wozu häufig auch die Kollegen zählten, dagegen offen und suchte Verbundenheit. So habe ich es von meinem Vater gehört, so erzählen es die Freunde meiner Eltern aus der DDR. Bei Vorgesetzten und Menschen mit Macht tun wir uns jedoch bis heute schwer.
Natürlich wurden Gemeinschaft und Bodenhaftung ganz groß geschrieben. Aber das hat mich auch viel gelehrt, was ich für essenziell halte, zum Beispiel: „Ich bin nicht der Nabel der Welt“. Dass dieses Verständnis im Westen nicht überall vorherrscht, habe ich schon als Kind mehrfach erlebt. Ich erinnere mich, wie meine Mutter Mitte der 90er einmal völlig fassungslos von einem Elternabend im Gymnasium kam, weil die Eltern der Klasse sich beschwert hatten, dass ihre Kinder so schlechte Französisch-Noten geschrieben hatten. Den Eltern war es nicht einmal in den Sinn gekommen, dass der Grund für die schlechten Noten auch mangelnde Vorbereitung gewesen sein könnte. Meine Mutter konnte nicht verstehen, warum man sich nicht zuerst fragt, ob der Fehler vielleicht bei der eigenen Vorbereitung liegt – oder ob das eigene Kind vielleicht doch nicht das schlauste im Raum ist. Die Lehrerin verließ den Elternabend übrigens weinend.
Diese Erdung, Authentizität und der Sinn für die Gemeinschaft macht die Ostdeutschen zu wichtigen Teammitgliedern. Grundsätzlich sind direkte und untaktische Menschen für Unternehmen wertvoll, egal ob aus dem Osten oder dem Westen des Landes und der ganzen Welt. Der Ostdeutsche ist für mich vor allem Sinnbild und Symbol gewisser Charaktereigenschaften, die zu selten gesehen werden. Aber diese sorgen dafür, dass man zusammenarbeiten kann und alle Kraft in die Aufgabe und das Ziel fließen kann, ohne dass das Ego im Weg steht. Sie sind das Gegenteil von toxischen Persönlichkeiten.
Wünsche an die Zukunft
Wie oft wünsche ich mir, Ulrike und Siegfried wären jetzt noch einmal 40. Sie hätten Jobs, garantiert. Weil sie immer eine Arbeit und Aufgabe wollten. Sie waren nie wählerisch, aber könnten es jetzt mitunter sogar sein. Denn Jobs findet man mittlerweile auch im Osten des Landes – wenn auch 20 Prozent schlechter bezahlt, 35 Jahre nach dem Mauerfall.
Was ich mir wünsche:
- Mehr Respekt und Anerkennung für die Generation, die sich die Freiheit erkämpft und teilweise bitter bezahlt hat – mit wirtschaftlichem Abstieg und dem Gefühl, nicht gebraucht zu werden oder einfach von der „falschen“ Seite der Mauer zu stammen.
- Junge, mutige Ostdeutsche bzw. junge, mutige Arbeiterkinder und Migranten, die mit ihrem Know-how, ihren Werten und ihrer Kultur die Chefetagen des Landes erobern.
- Ein Miteinander auf Augenhöhe. Ein Establishment, das weniger darauf bedacht ist, Machtpositionen für sich und seinesgleichen zu erhalten, sondern Vielfalt als Chance begreift.
Ich bin glücklich und voller Dankbarkeit, dass ich in beiden Welten aufwachsen konnte. Nicht politisch, aber kulturell. Ich widme diesen Text den zum Zeitpunkt der Wende 16,4 Millionen Menschen und Schicksalen. Vor allem widme ich diesen Text der Generation meiner Eltern und meiner elf Jahre älteren Schwester, deren Leben mittendrin noch einmal völlig neu begann.

Das Team von nebenan.de. 20 Nationen und rund 100 verschiedene Lebenswege. Abbildung: Ina Remmers
Ina Remmers
GEBOREN: 1983/Zwickau
WOHNORT (aktuell): Berlin
MEIN BUCHTIPP: Sabine Rennefanz: „Kosakenberg“, 2024
MEIN FILMTIPP: „Gundermann“, 2018
MEIN URLAUBSTIPP: Erzgebirge
 BUCHTIPP: BUCHTIPP:
„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Dieser Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2024, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |