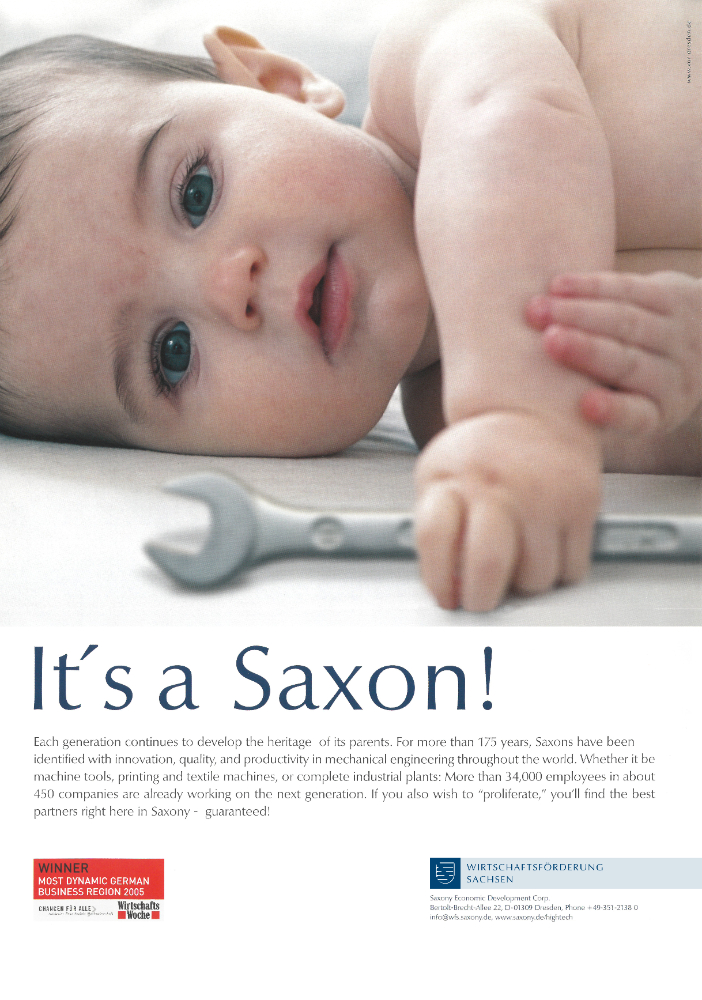Thomas Horn, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS), ist ein wichtiger Impulsgeber für Ostdeutschland. Er setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist er auch in dem Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.
Ich wurde 1969 in der DDR, in Schöneck im oberen Vogtland geboren. Das liegt im südwestlichsten Zipfel Sachsens. Landläufig bekannt ist die Region vor allem als „Musikwinkel“. Hier werden seit Jahrhunderten Musikinstrumente hergestellt. Auch der Wintersport hat mit den Weltcups im Skispringen und der Nordischen Kombination in Klingenthal zur Bekanntheit beigetragen.
Aufgewachsen bin ich in der Nähe von Freiberg in Sachsen – mit großem Interesse an der weiten Welt, die für mich im Unterschied zu dem, was der Globus oder Schulatlas zeigten, allerdings doch recht klein war. Vor allem, wenn mir mein Urgroßvater, der in jungen Jahren zur See gefahren war, von fernen Ländern wie Japan oder Singapur erzählte. Dann fragte ich mich, ob ich jemals auch solche Länder besuchen würde. Schließlich war das in der DDR nur wenigen möglich. Vor allem Sportlern, die bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften reihenweise Medaillen gewannen. Dazu noch vereinzelten Künstlern und Wissenschaftlern. Aber es gab einige wenige Berufe, die die Tür in die Welt öffnen konnten, vor allem im Außenhandel. Den hatte auch die planwirtschaftliche DDR, um Waren zu verkaufen und um Rohstoffe oder Produkte einzukaufen, die es hier nicht gab. Das waren nicht nur Bananen oder Baumwolle, sondern auch Maschinen und Anlagen. Ich hatte also einen Plan.
Dafür war es sehr hilfreich, dass ich schon seit der 3. Klasse an der Polytechnischen Oberschule „erweiterten Russischunterricht“ hatte. Denn das für meinen Plan erforderliche Studium gab es nur an ganz wenigen Hochschulen, darunter auch in Moskau. Nach mehreren Tests und einem mehrstufigen Auswahlverfahren gelang es mir tatsächlich, einen solchen Studienplatz zu ergattern. Nach Abitur, einigen Monaten Erfahrungen in einer LPG und im VEB Kombinat Mikroelektronik sowie 18 Monaten NVA-Grundwehrdienst trat ich im August 1989 mein Studium der „Internationalen Wirtschaftsbeziehungen“ in Moskau an.
Was für ein Kulturschock: Die berühmte Sowjetunion sah nach mehreren Jahren Perestroika und Glasnost gar nicht mehr so strahlend aus. Versorgungslage, Infrastruktur und Lebensstandard waren in der DDR deutlich besser. Dieser Unterschied sollte noch viel größer werden. Am Morgen des 19. Oktober 1989 kamen sowjetische Kommilitonen auf mich zu und teilten mir mit: „Honecker ist weg“. Von da an nahmen die großen Veränderungen in der Heimat ihren Lauf. Als ich im Januar 1990 wieder deutschen Boden betrat, war klar, dass es nie mehr so sein würde wie vorher. Und: Das war gut so!
Die ersten Jahre nach dem Fall der Mauer und der wunderbaren deutschen Wiedervereinigung waren aber auch die Zeit, in welcher der Begriff „der Osten“ bzw. „Ostdeutschland“ von einer geografisch korrekten Bezeichnung zu einem politisch geprägten Begriff wurde. Und das war, so fühlt es sich jedenfalls im Rückblick an, überhaupt nicht gut.
Für mich bedeuteten die Veränderungen, dass ich meinen Plan überdenken und neu justieren musste. Schnell war klar, dass ich mein Studium fortsetzen wollte, um später in einem international tätigen Unternehmen zu arbeiten, möglichst in Sachsen. Allerdings stellte sich das 1994 als sehr schwierig dar. Die Arbeitslosigkeit lag damals bei etwa 15 Prozent. Was für ein Glück, dass ich am 1. August als junger Uniabsolvent bei der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) in Dresden anfangen konnte.
Und bitte lassen wir Ostdeutschland einfach wieder eine geografische Bezeichnung sein.”
Aufbaujahre
Damals hatte die WFS mit dem Ziel der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen zwei zentrale Aufgaben: Investitionen nach Sachsen holen, Firmen ansiedeln sowie den verbliebenen und inzwischen privatisierten oder neu gegründeten sächsischen Unternehmen die Türen auf den Weltmärkten öffnen. Ich selbst war als Projektleiter im „Zentrum für Exportunterstützung Sachsen“ für die Markterschließung in Osteuropa zuständig. Wir halfen, indem wir bei der Gewinnung von Kontakten, Geschäftspartnern und Aufträgen unterstützten. Und das war definitiv kein „easy win“. Die früheren Geschäftsbeziehungen aus der Zeit des RGW (englisch: COMECON) existierten nicht mehr, die neuen bzw. privatisierten Firmen hatten kaum Ressourcen für die Markterschließung und die potenziellen Kunden in Osteuropa waren mit ihren einheimischen Währungen wenig kaufkräftig. Hinzu kam der immense Druck der „westdeutschen“ Wettbewerber, die ebenfalls in diese Märkte drängten.
Dennoch: Jeder Kontakt, jeder noch so kleine Vertragsabschluss zählte, um in den jungen Betrieben Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Noch mehr als heute zählten damals die unmittelbaren persönlichen Kontakte. Schließlich gab es Social Media und Videokonferenzen noch nicht. E-Mails waren nicht allgemein üblich und selbst ein Fax war für viele Luxus. So organisierten wir „am Fließband“ analoge Informationstage, Unternehmerreisen und Messebeteiligungen. Aus diesen Anfängen hat sich Sachsen bis heute zu einem international vernetzten Wirtschaftsstandort entwickelt, der weltweit Handelsbeziehungen pflegt und mehr als ein Drittel seines BIP im Export erwirtschaftet.
Im anderen Bereich – der Gewinnung von Investoren – setzte die sächsische Staatsregierung zusammen mit der WFS ganz bewusst auf große industrielle „Leuchttürme“ und den gezielten Ausbau von Wissenschaft und Forschung an den Hochschulen und in außeruniversitären Einrichtungen. Eine Wirtschaftspolitik, die immer wieder kontrovers diskutiert wurde, aber aus heutiger Sicht ein wesentlicher Anker der erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung war und ist.
Ohne die Ansiedlungen von Volkswagen in Zwickau, Chemnitz und Dresden, BMW und Porsche in Leipzig, von Siemens (heute Infineon) und AMD (heute Globalfoundries) in Dresden, den Erhalt der großen Bahntechnikstandorte in Bautzen und Görlitz, den Ausbau des Flughafens Leipzig-Halle als Frachtdrehkreuz und vielen anderen wegweisenden Investitionsentscheidungen – wie zum Beispiel im Maschinen- und Anlagenbau in Chemnitz, Westsachsen und im Erzgebirge – würde es heute die vielfältige und wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmenslandschaft von KMU so nicht geben. Längst strahlen nicht mehr nur die „Leuchttürme“, sondern es ist ein „Lichtermeer“ in der Fläche entstanden.
1997 wechselte ich mit meinem Know-how aus der WFS zur zwischenstaatlichen Deutsch-Polnischen Wirtschaftsfördergesellschaft AG. Über Stationen im Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft und in der Sächsischen Staatskanzlei kehrte ich schließlich 2018 nach 21 Jahren als Geschäftsführer in die WFS zurück.
Erfolgreicher Hightech-Standort
Die wirtschaftliche Situation ist heute völlig anders als in den 1990er-Jahren. Das ist Sachsen aber nicht „in den Schoß gefallen“. Dahinter stecken viele Jahre harte Arbeit und schmerzliche Erfahrungen mit Massenarbeitslosigkeit und niedrigen Einkommen. Aber vor allem Mut und Tatkraft, um anzupacken, die Fähigkeit zu Innovationen, unternehmerisches Engagement sowie die zielgerichtete Unterstützung durch staatliche Wirtschafts- und Technologieförderung und ein konsequenter Ausbau der notwendigen Infrastrukturen.
Inzwischen ist Arbeitslosigkeit kein Thema mehr, sondern wir beschäftigen uns mit dem wachsenden Bedarf an Fachkräften. Dazu kommen industrielle Transformationsprozesse in Verbindung mit neuen Technologien – vom autonomen Fahren über Robotik, Biotechnologie bis hin zu Quantencomputing. Diese unterstützen wir mit branchenübergreifender Arbeit, um noch mehr Wachstum der sächsischen Firmen zu erreichen und um bei den inzwischen zahlreichen „Hidden Champions“ der KMU und Start-ups das Wort „Hidden“ streichen zu können.
Gleichzeitig ist die Zeit der großen Ansiedlungen nicht vorbei. Die im August 2023 verkündete Entscheidung des Weltmarktführers TSMC aus Taiwan, in Dresden seine erste europäische Chipfabrik zu bauen, ist ein neuer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte des Hightech-Standortes Sachsen, dem sicher weitere folgen werden.
Darauf werden wir bei vielen Projekten in Europa, aber auch in Amerika und Asien immer wieder angesprochen. Niemand stellt dabei die Frage, in welchem (ehemaligen) Teil Deutschlands Sachsen liegt. Sondern man fragt, wie das gelungen ist und wie man mit uns kooperieren kann, um an dieser Erfolgsgeschichte teilzuhaben. Der Begriff „Ostdeutschland“ spielt also für Dritte keine Rolle.
Warum beschäftigen wir uns dann immer noch damit? Weil es speziell in den 1990er-Jahren wirtschaftlich nicht so gelaufen ist wie erhofft. Weil das Eigentum in Ostdeutschland ungleich verteilt ist. Weil weniger Ostdeutsche in Führungspositionen sind, als es zahlenmäßig der Bevölkerungsstruktur entspricht. Weil Personen über unsere Geschichte urteilen, die sie nicht selbst erlebt haben. Weil, weil, weil …
Ja, viele dieser Punkte treffen zu. Viele dieser Punkte sind aufgearbeitet und diskutiert worden. Einige allerdings noch nicht oder zumindest nicht hinreichend. Aber bei all diesen Diskussionen bleibt stets ein negativer Nachklang. Bringt uns das weiter? Eher nicht!

Grundsteinlegung für Porsche in Leipzig im Jahr 2000: Wolfgang Tiefensee (Oberbürgermeister), Dr. Wendelin Wiedeking (Vorstandsvorsitzender), Prof. Dr. Kurt Biedenkopf (Ministerpräsident Sachsen), Dr. Kajo Schommer (Sächsischer Staatsminister für Wirtschaft und Arbeit) – v. l. n. r. Abbildung: WFS
Den Blick nach vorn gerichtet
Sollten wir als Ostdeutsche 34 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht auch selbst mit diesen Diskussionen aufhören? Stattdessen akzeptieren, dass es so gewesen ist und jetzt rückwirkend nicht mehr geändert werden kann? Zugegeben: Vielleicht würde das manchmal einfacher fallen, wenn in Deutschland insgesamt die Akzeptanz hinzukäme, dass es diese Punkte gibt.
Ich jedenfalls will kein Mitleid dafür oder aufmunterndes Schulterklopfen, nur weil ich „Ostdeutscher“ bin. Ich bin Sachse, genau genommen Vogtländer. Und das liegt geografisch im Osten Deutschlands. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe die Dinge selbst in der Hand, kann gestalten in Freiheit und Demokratie. Ich stehe für einen weltoffenen, international vernetzten und wirtschaftlich erfolgreichen Hightech-Standort in der Mitte Europas. Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben und dass wir alle Chancen haben, dies weiter zu entwickeln und auch für unsere Kinder und Enkel eine wunderbare Zukunft zu gestalten. Das finde ich großartig.
Lasst uns alle gemeinsam mehr auf das stolz sein, was wir geschaffen haben und was andere Nationen gern hätten. Dieses gemeinsame Deutschland ist das beste Deutschland, was es je gab.
Und bitte lassen wir Ostdeutschland einfach wieder das sein, was wir auf dem Globus oder im Atlas sehen können: eine geografische Bezeichnung in der Mitte Europas.
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS)
GEGRÜNDET: 1991
STANDORT: Dresden
MITARBEITENDE: 65
WEBSITE: standort-sachsen.de
Thomas Horn
GEBOREN: 1969/Schöneck (Vogtland)
WOHNORT (aktuell): Dresden
MEIN BUCHTIPP: Wolfgang Herrndorf: „Tschick“, 2010
MEIN DOKUTIPP: „Wem gehört der Osten?“, 2015
MEIN URLAUBSTIPP: Nationalpark Sächsische Schweiz
 BUCHTIPP: BUCHTIPP:
„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Dieser Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2024, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |