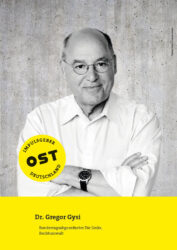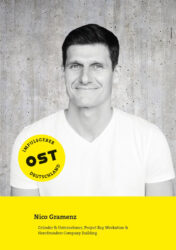Mit „Möbel aus der Zukunft“ erzählt Sascha Lange vom Boom futuristisch designter Möbel in der DDR. Er zeigt, wie trotz Planwirtschaft und begrenzter technischer Mittel Pionierarbeit geleistet wurde.
Wer einen Science-Fiction-Film aus alter Zeit sieht, muss oft schmunzeln, wenn einem vor Augen geführt wird, wie man sich damals die Zukunft vorstellte. So ergeht es manchmal auch dem Leser von Sascha Langes Sachbuch „Möbel aus der Zukunft“. Es wirft einen Blick auf das sogenannte „Space Age“ – eine Epoche des technischen Fortschritts, in der die erste Mondlandung noch aktuell war, alles möglich erschien und die Welt von morgen oft in schillerndsten Farben ausgemalt wurde. Wegwerfunterwäsche sollte in wenigen Jahren selbstverständlich sein, so eine Prognose der „Schöner Wohnen“ aus dem Jahr 1970. Seine Mahlzeiten würde man fertig und in Kunststoff verpackt aus dem Laden holen und zu Hause nur noch erwärmen. Reste und Geschirr würden nach Verzehr dann in den Müllschlucker wandern. Nachhaltigkeit stand damals definitiv noch nicht auf der Karte.
Vom Kunststoff zum Kunstwerk: Design im Kalten Krieg
Eigentlich geht es in dem Buch aber gar nicht um Speisen. Auch nicht um Unterwäsche. Es geht um Möbel. Um Design. Um Material. Es geht um die Geschichte der Polyurethan-Erzeugnisse aus der Zeit des Kalten Krieges. Der Autor nimmt den Leser mit auf eine Reise durch die 1960er- und 1970er-Jahre, als futuristisch anmutende Ausstattung in West- und Ostdeutschland boomte und Kunststoff als Substanz der Zukunft galt. Treffend bebildert wird erzählt, wie die BRD mit Unternehmen wie Bayer und Designern wie Verner Panton eine Vorreiterrolle in der Herstellung von Kunststoffmöbeln einnahm. Damals wurden ikonische Stücke wie der Panton-Chair oder das Garten-Ei entwickelt, die weltweit Beachtung fanden. Die zahlreichen Abbildungen beweisen: Viele Möbelstücke sind nicht nur echte Hingucker, sondern wahre Kunstwerke, für die mancher heute auch ein Museumsticket lösen würde. Die futuristische Formensprache bei gleichzeitigem Retro-Chic wirkt insbesondere aus heutiger Perspektive äußerst ansprechend – einige der Stühle wirken, als seien sie direkt für die Kommandobrücke des Raumschiffs Enterprise entworfen worden.
Pioniergeist trotz Planwirtschaft
Ein besonderes Augenmerk legt Lange auf die parallele Entwicklung in der DDR, wo der Kunststoff Polyurethan ebenfalls entdeckt wurde. Trotz Planwirtschaft und begrenztem Zugang zu westlicher Technologie gelang es im Osten, eigene Kunststoffmöbel zu produzieren. Besonders spannend ist dabei die Rolle Axel Bruchhäusers, ein Unternehmer aus Güstrow, der trotz staatlicher Kontrolle Pionierarbeit leistete. Der Autor analysiert die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aspekte dieses Prozesses und zeigt, wie die Rivalität zwischen Ost und West auch in der Möbelproduktion zum Ausdruck kam.
Gestaltung und Geschichte
„Möbel aus der Zukunft“ ist eine aufwändig recherchierte Studie, die auch deswegen so fesselnd ist, weil sie die beschriebenen technischen Innovationen mit politischen Entwicklungen verknüpft. Das macht das Buch nicht nur für Liebhaber von Form und Gestaltung empfehlenswert, sondern auch für Geschichtsinteressierte und Leser, die sich gern mit deutsch-deutschen Vergleichen beschäftigen. Zahlreiche Bezüge zur Gesellschaft und Kultur der 1960er- und 1970er-Jahre heben die Lektüre über eine reine Designgeschichte hinaus. Die Darstellung der wirtschaftlichen Herausforderungen in der DDR sowie der kreativen Lösungsansätze ihrer Unternehmer verleiht der Schilderung zusätzliche Tiefe. Das Buch endet mit einem Blick auf den heutigen Vintage-Markt, wo Möbel aus dieser Zeit wieder an Wert gewinnen, was vor allem eines beweist: Die Zukunft besteht tatsächlich aus Plastik.

Sascha Lange: „Möbel aus der Zukunft“, Links-Verl. 2024, 208 Seiten (Softcover), 30,00 €. |