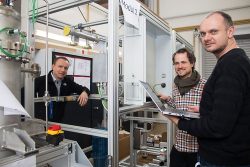Die Wahl zur Volkskammer der DDR am 18. März 1990 war der erste Urnengang unter demokratischen Bedingungen. Der Publizist, Schriftsteller und Beauftragter des Vorstandes Deutsche Gesellschaft e.V. Dr. Andreas H. Apelt schildert, wie er diesen Tag erlebt hat.

Wolfgang Schnur, Vorsitzender des Demokratischen Aufbruchs im Kongresssaal des Brühlzentrums. Abbildung: Bundesarchiv, Bild 183-1989-1216-021 / Gahlbeck, Friedrich / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, Creative-Commons-Lizenz
Revolutionen gebären ihre eigenen Geister. Diesen Satz schrieb ich im Februar 1990 in mein Tagebuch. In den Sinn kam er mir, als ich Zeuge eines merkwürdigen Wahlkampfauftrittes wurde. Der Redner war kein geringerer als Wolfgang Schnur, immerhin Vorsitzender des Demokratischen Aufbruchs (DA), einer neuen, Ende Oktober 1989 gegründeten oppositionellen Vereinigung in der DDR und ab Mitte Dezember Partei. Er stand auf dem Markt in Halle an der Saale und seine Augen leuchteten geradezu diabolisch, als er einer staunenden Menschenmenge verkündete: „Hier steht euer neuer Ministerpräsident.“ Derartig dick aufzutragen hatte sich bisher niemand gewagt. Auch kein Wolfgang Schnur, Anwalt und Kirchenjurist, dem es nicht an Selbstbewusstsein mangelte. Doch irgendetwas hatte sich geändert.
Wie stark sein Ego ausgeprägt war, zeigte sich auf der Rückfahrt nach Berlin. Als Beifahrer kurbelte Schnur auf der Autobahn unvermittelt das Seitenfenster des Wagens herunter, schob den Oberkörper bis zu den Hüften aus dem Wageninneren und schrie wiederholt gegen den Fahrtwind an: „Ich, Wolfgang Schnur, bin der neue Ministerpräsident.“
Wie bei seinen Mitfahrern, die fürchteten, der Spitzenkandidat des DA könne aus dem Auto fallen, sah man auch auf dem Hallenser Marktplatz entsetzte Gesichter. Kopfschütteln machte die Runde. Noch mehr bei den Funktionären der Partei, die aufgrund einer Hauptausschusssitzung mitgereist waren, auch um sich Schnur gegenüber solidarisch zu zeigen. Schließlich war er mehrfach hart angegriffen worden, unterstellte man ihm doch eine Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit. Beweise gab es bis dahin keine und Menschen zu beschuldigen gehörte in diesen unruhigen Zeiten allgemeinen Misstrauens zum Volkssport.
Als Mitglieder des Ausschusses wussten wir um den Zustand der Partei und die inhaltlichen Auseinandersetzungen. Es war völlig vermessen, an einen Wahlsieg des DA zu denken, zumal dieser erhebliche Federn gelassen hatte und durch quälende Debatten noch mehr Zeit verlor. Mit dem linken Flügel verließen auch namhafte Gründungsmitglieder wie Friedrich Schorlemmer, Rudi Karl Pahnke, Edelbert Richter, Ehrhart Neubert oder Günter Nooke die Partei, die sich trotzdem schwertat, eine politische Richtung vorzugeben. Da nutzten auch stundenlange Vorstandssitzungen nichts, bei denen ohnehin keine greifbaren Ergebnisse erzielt wurden. So war schon im Januar nicht an einen großen Erfolg zu denken, zumal sich die Partei nur langsam von den personellen Aderlässen erholte. Die Situation verschärfte sich noch, als am 28. Januar 1990 in einer Besprechung zwischen der Regierung und den Vertretern des Runden Tisches im DDR-Gästehaus der Wahltermin vom 6. Mai auf den 18. März vorgezogen wurde. Das brachte gerade die neuen oppositionellen, materiell schlecht ausgestatteten Gruppierungen unter enormen Zugzwang. Darüber hinaus hatten die Mitbewerber, allen voran die aus der „Nationalen Front der DDR“ ausgetretene Ost-CDU mit ihrer Vergangenheit gebrochen. Eine programmatische Erneuerung durch ein Bekenntnis zur Sozialen Marktwirtschaft und zur Wiedervereinigung sowie die Wahl von Lothar de Maizière zum neuen CDU-Vorsitzenden hatten erheblich zur Reputation der einstigen Blockpartei beigetragen. Für Schnur und den DA wurde fortan die Luft noch dünner.
Böhme inszenierte sich als Kumpeltyp
Vor allem aber gab es die SDP, im Oktober 1989 in Schwante gegründet, die sich noch rechtzeitig vor den Wahlen in SPD umbenannt hatte. Ihr Vorsitzender Ibrahim Böhme behauptete nicht nur Ministerpräsident zu werden, sondern er führte sich schon als solcher auf. So kam er im Anzug nebst Weste und Schlips akkurat gekleidet in einer dunklen Limousine vorgefahren, lächelte in die Kameras und negierte die übrigen Anwesenden mit einer gewissen Arroganz. Aufwertung erfuhr er zusätzlich in der Bonner SPD-Zentrale, als er sich vor laufenden Kameras mit Männern wie Willy Brandt und Hans-Jochen Vogel als Kumpeltyp inszenierte. Und das so selbstsicher, als gehörte er seit Jahren zum Establishment. An seinem Wahlsieg hatte auch die sowjetische Regierung keinen Zweifel. Schließlich wurde er bereits vor den Wahlen nach Moskau eingeladen und entsprechend hofiert. Den Wahlsieg der Genossen prognostizierten auch die Berliner politischen Beobachter und bestätigten damit eine telefonische Wahlumfrage. Rückenwind gab es auch für die SPD durch die haushoch gewonnene Landtagswahl im Saarland. Das hinterließ im Osten Spuren.
Auch Lothar de Maizière sah sich schon als Ministerpräsident. Er hätte das nie öffentlich gesagt. Doch als ich ihn anlässlich seines Geburtstages am 2. März im Sitz der Ost-CDU am Gendarmenmarkt traf, überraschte er eine Handvoll Gäste mit der hypothetischen Frage, was er wohl tun solle, wenn er nun Ministerpräsident werde. Ich war enttäuscht, denn eigentlich hatte ich dem Mann, mit dem ich kurze Zeit vorher den ersten gesamtdeutschen Verein gegründet hatte, mehr Realitätssinn zugetraut. Wie nur, dachte ich, konnte er annehmen, mit der ehemaligen Block-CDU Wahlsieger zu werden? Was mir und den meisten Beobachtern entging, war die Situation fernab der Hauptstadt. Das führte zu einer Betriebsblindheit, dabei war das schwarz-rot-goldene Fahnenmeer gerade im Süden der Republik nicht zu übersehen. Die DDR war eben nicht Berlin.
DDR-Bürger kannten sich mit West-Parteien aus
Vom Sieg träumte trotzdem noch so manch ein DDR-Dissident. Dabei gingen sie von der irrigen Annahme aus, dass ihr mutiges Auftreten vom Wahlvolk honoriert werden würde. Ganz nach dem Bibelwort „Undank ist der Welt Lohn“ gab es von den Wählern keinen Dank. Das Gegenteil war der Fall. Die neuen Gruppierungen, allen voran das Neue Forum, hatten zwar die revolutionären Entwicklungen angestoßen, waren aber als Bürgerbewegung, die ein viel zu breites Spektrum vertreten wollte, nicht mehr attraktiv. Zu unterschiedlich waren die Auffassungen, wenn es um mehr als die reine SED-Gegnerschaft ging. Joachim Gauck in Rostock und Arnold Vaatz in Dresden waren eben um Meilen von Bärbel Bohley entfernt und schlugen ganz andere Töne an. Das aber schmälert nicht ihren Verdienst. Dazu kam, dass den DDR-Bürgern das Parteienschema West vertraut war, hiermit konnten sie etwas anfangen. Sie wussten bei der abendlichen Ausreise per Fernsehschirm, wofür welche Partei im Westen steht und kannten alle wichtigen Repräsentanten. Da hatten es die eigenen Revolutionsgewächse, viele erst im Winter 1989/90 entstanden, deutlich schwerer.
Obgleich zunächst von den Oppositionskräften vereinbart wurde, auf Westhilfe zu verzichten, rollte bald massive Wahlkampfhilfe von Mensch und Material von West nach Ost. Dabei unterstützten sich insbesondere die Parteifamilien. Schwer hatten es jene, die weder Parteischwestern noch Adoptiveltern fanden. Oder jene, die auf eine eigene Ausrichtung nicht verzichten wollten. Hier betraf es einmal mehr die Listenvereinigung Bündnis 90 (Neues Forum, Demokratie Jetzt, Initiative Frieden und Menschenrechte).
Als große Hilfe können auch die Rednerauftritte in der DDR gewertet werden. West-Redner füllten von der Ostsee bis zum Erzgebirge die Marktplätze mit Hunderttausenden. Zuweilen schien es, als würden Popidole auftreten. Einen derartigen Zulauf kannte man auch im Westen nicht oder nicht mehr. Davon profitierten vor allem die SPD, der Bund Freier Demokraten (F.D.P der DDR, LDP, DFP) und das liberal-konservative Wahlbündnis der Allianz für Deutschland. Dies war keine Listenvereinigung, sondern ein lockeres Bündnis aus der Ost-CDU, der in Leipzig gegründeten CSU-Schwesterpartei Deutschen Sozialen Union (DSU) und dem Demokratischen Aufbruch. Dass dieses Bündnis überhaupt zustande kam, glich eher einem Wunder, zumal die drei Partner oftmals zähneknirschend aufeinander zugingen. Lange Zeit hatte CDU-Generalsekretär Volker Rühe es abgelehnt, mit der ehemaligen Block-CDU zu reden und nur den DA als zu unterstützende Partei anerkannt. Letztendlich war es Helmut Kohl, der sich nach einem Gespräch mit Lothar de Maizière von den strategischen Vorteilen der Ost-CDU überzeugen ließ. Dazu gehörte ein flächendeckendes Netz von Kreisgeschäftsstellen inklusive hauptamtlicher Angestellter. Ost-West-Patenschaften von Orts-, Kreis-, und Landesverbänden boten sich geradezu an und würden manchen Nachteil ausgleichen.
Vier Tage vor der Wahl platzte die Bombe
Doch vier Tage vor der Wahl platzte die Bombe. Ausgerechnet der Vorsitzende des DA, Wolfgang Schnur, wurde als Stasizuträger enttarnt, ein Desaster für die DA-Wahlkämpfer, die seit Monaten bis zur Erschöpfung arbeiteten. Verzweiflung machte sich breit. Schnur wird noch am gleichen Tag aus der Partei geworfen, mit Rainer Eppelmann ein neuer Vorsitzender gewählt. Doch was bedeutet das für die Wahl?
Mit Spannung wurden am 18. März die Wahlergebnisse der 24 Parteien und Gruppierungen erwartet. 400 Sitze sind zu vergeben. Es ist eine einfache Verhältniswahl, der Wähler hat nur eine Stimme. Beachtlich ist schon die Wahlbeteiligung von 93,4 Prozent, ein Wert, der seitdem nicht mehr erreicht wird. Entgegen allen Prognosen wird die CDU mit 40,8 Prozent der Stimmen mit Abstand die stärkste Kraft. (Die Allianz errang 48 Prozent.) Allerdings hat sie ihren Sieg den Bezirken außerhalb Berlins zu verdanken, denn in der Hauptstadt kommt sie nach der SPD und der PDS gerade mal auf Platz drei. Den zweiten Platz belegte die SPD mit 21,9 Prozent, eine Riesenenttäuschung, den dritten Platz mit immerhin 16,4 Prozent die PDS. Der Demokratische Aufbruch erhielt nur 0,9 Prozent der Stimmen. Und doch wartet ein Trostpflaster. Da der Gesetzgeber auf eine Fünf-Prozent-Hürde verzichtete, ziehen vier DA-Abgeordnete, die sich der CDU-Fraktion anschließen, in die Volkskammer. Der Demokratische Aufbruch allerdings wird sich nie mehr erholen. Fortan sind seine Tage gezählt.
 Abbildung: Yasin Jonathan Kandil Dr. Andreas H. Apelt Publizist, Schriftsteller, Mitbegründer und Beauftragter des Vorstandes Deutsche Gesellschaft e.V. |