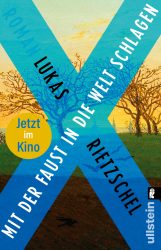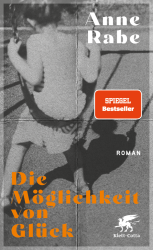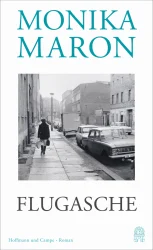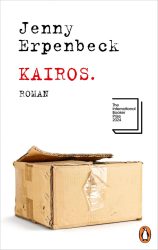Im vierten Teil seiner Kolumne widmet sich Dr. Tobias Lehmann dem Roman „Die Geschwister“ von Brigitte Reimann. Er beleuchtet die aktuelle Wiederentdeckung des Werks, dessen autobiografische Bezüge sowie den Entstehungshintergrund im Kontext des Bitterfelder Wegs.

Dr. Tobias Lehmann hat an der University of Oregon zum Thema Wendeliteratur promoviert. Geboren 1981 in Eisenhüttenstadt war er lange Zeit in Südkorea und anschließend in den USA tätig.
Brigitte Reimann nutzte die ihr zugestandene künstlerische Freiheit und hielt das Leben in der DDR fest – samt ihrer eigenen zerrissenen Verpflichtungen. In einem entwaffnend direkten Stil, der von Dialogen und Details lebt, erweckte Reimann die berauschende, unmögliche Versuchung, die eigenen Ideale zu leben.

Der Roman „Die Geschwister“ von Brigitte Reimann ist im Aufbau-Verlag erschienen.
Reimanns 1963 erschienener Roman „Die Geschwister“ (Aufbau-Verlag) wurde kürzlich von Lucy Jones ins Englische übersetzt, nachdem das unzensierte Manuskript und die nachträglichen Korrekturen der Autorin im vergangenen Frühjahr zufällig entdeckt worden waren. Es geht um Debatten über den sozialistischen Realismus und den künstlerischen Umgang mit ihm, die in einer Kohlebrikettfabrik kontrovers geführt werden. 1959 verkündete die SED nämlich, ihre Schriftsteller sollten dem „Bitterfelder Weg“ folgen. Diese Initiative zielte darauf ab, Autoren in industrielle Umgebungen einzubinden, um ihr Elitedenken zu schwächen und gleichzeitig der Arbeiterklasse Kultur näherzubringen. Der Slogan „Greif zur Feder, Genosse; die deutsche sozialistische Nationalkultur braucht dich!“ brachte diesen Aufruf zum Ausdruck.
Reimann, Tochter eines Bankangestellten aus einer Kölner Bürgerfamilie, hatte sich im Alter von 14 Jahren, als sie sich von einer Kinderlähmung erholte, entschlossen, Schriftstellerin zu werden. Mit 17 veröffentlichte sie ihr erstes Buch mit Theaterstücken. Mit 20 heiratete sie einen Maschinenschlosser, brachte ein Kind zur Welt, das noch am selben Tag starb, und unternahm wenig später einen Selbstmordversuch. Im Alter von 27 Jahren war sie bereits seit vier Jahren Mitglied der Schriftstellergewerkschaft der DDR und hatte einige vielversprechende Novellen geschrieben, während sie gleichzeitig als Lehrerin arbeitete, um über die Runden zu kommen. Im Jahr 1960 folgte sie dem Ruf der Partei. Nach der Scheidung von ihrem Mann (dem ersten von vier) zog sie in eine abgelegene Stadt in Sachsen, um in einem Kohlewerk zu arbeiten. Dort arbeitete sie mit ihrem Geliebten, einem Schriftstellerkollegen, und organisierte unter den Werktätigen eine Kulturbrigade. Sie las ihnen ihre Geschichten vor und brachte ihnen bei, eigene zu schreiben. Das war der Bitterfelder Weg.
Sie zog dorthin zum einen, um ihre Geldsorgen zu lösen, zum anderen, weil es ein „Abenteuer“ war: Es war nicht so, dass sie glaubte, der Staat wisse, was er tat, wenn es um Literatur ging. Seit Jahren, so schreibt sie in ihr Tagebuch, seien kaum noch gute Bücher erschienen: „Überall Opportunisten und Dummköpfe. Das einzige Thema, das es wert ist, in einem Roman behandelt zu werden, scheint die Notwendigkeit zu sein, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen. Menschliche Probleme liegen nicht im Trend.“ Aber die Romane, die sie während ihrer Zeit in der Fabrik entwickelte, „Ankunft im Alltag“ (1961), „Die Geschwister“ (1963) und „Franziska Linkerhand“ (1974), sind voll von Menschen mit Problemen, die zufällig in Fabriken oder Werften arbeiten. Reimann hielt sich an die Regeln, was in der DDR veröffentlicht werden durfte: nur „positive Helden“, keine unglücklichen Enden, ein Teil spielt in einer Fabrik, und das Ganze wird vom staatlichen Verlagsapparat geprüft bzw. zensiert. Dennoch gelang es ihr, den berauschenden, unmöglichen Reiz, die eigenen Ideale zu leben, zum Leben zu erwecken.
Zu Lebzeiten wurde Reimann mit dem Heinrich-Mann-Preis ausgezeichnet. Ihr letzter unvollendeter Roman „Franziska Linkerhand“, der nach ihrem Krebstod im Alter von 39 Jahren veröffentlicht wurde, war Kult. Er schilderte die zunehmende Desillusionierung der Protagonistin in Bezug auf Liebe, Arbeit und die DDR selbst, eine Situation, die Reimanns eigene widerspiegelte. Die Veröffentlichung war Ergebnis der kurzlebigen Periode kultureller Freizügigkeit, die Erich Honecker nach seiner Machtübernahme einführte.
Doch Reimanns Werk blieb jahrelang unbeachtet. Es knüpfte weder an feministische Traditionen an, wie das ihrer Freundin Christa Wolf. Noch war es Teil der Nachkriegsaufarbeitung, wie das ihres Idols Anna Seghers. In Deutschland war Reimann bis vor Kurzem vielleicht am bekanntesten, weil sie von Martina Gedeck in „Hunger auf Leben“ gespielt wurde, einem Dokumentarfilm, der auf ihren mit Sex gefüllten, quälenden Tagebüchern basiert, die ab 1983 in Ost- und Westdeutschland in immer vollständigeren Ausgaben erschienen. Unter den deutschen Lesern sind die Tagebücher wegen ihres klaren Blicks auf das Leben in der DDR und wegen ihres lebendigen Porträts einer jungen Künstlerin, die sowohl verführt als auch verführt wird, sehr beliebt. In diesem Jahr, ein halbes Jahrhundert nach Reimanns Tod, wurden ihre Bücher in Deutschland neu aufgelegt – in Pastellfarben, wie man sie auch auf einem aktuellen Prada-Laufsteg finden könnte. Menschliche Probleme sind wieder en vogue.
„Die Geschwister“ spielt kurz nach Ostern 1960, als Reimanns Heldin, die 24-jährige Malerin Elisabeth Arendt, versucht, ihren Bruder Uli davon zu überzeugen, nicht in den Westen zu gehen. Die Berliner Mauer wurde zwar offiziell erst am 13. August 1961 errichtet, aber sie existierte, wenn auch nur in den Köpfen, schon lange vorher. Zwei Ostern zuvor war bereits Elisabeths älterer Bruder Konrad in ihr Zimmer gekommen, um sich zu verabschieden. Als sie den „ungewohnten, stockenden“ Tonfall des Auf-Wiedersehen-Sagens ihrer Mutter hörte, wurde ihr klar, dass ihr Bruder nicht wiederkommen würde. In Briefen aus einem Durchgangslager in Westdeutschland gesteht Konrad seinen „Verräterkomplex“, aber das Ausmaß seines ideologischen Bruchs mit der Familie wird deutlich, als Elisabeth und ihre Mutter ihn nach seiner Etablierung im Westen aufsuchen. Er lädt sie zum Essen in das Nobelhotel Kempinski ein. Konrad wirft Elisabeth Romantik vor, wenn sie von ihrer Arbeit als Leiterin eines Malerkreises in der örtlichen Fabrik erzählt. Elisabeth konfrontiert ihn mit der Ansicht der Familie, dass er ein Gauner sei, weil er sein Studium von der DDR bezahlen ließ, um dann seine Ingenieurskunst in den Westen zu tragen. Sie können sich nicht einmal darüber einigen, ob die DDR ein Staat ist: „‚Es heißt nicht Zone. Es heißt DDR. Ich red ja auch nicht von der Westzone. So viel Achtung kann ich für unseren Staat schon verlangen.‘ ‚Staat …‘, sagte Konrad. ‚Ein paar Quadratkilometer ärmliches Land; eine Regierung, die von den Sowjets ausgehalten wird …‘ Wir sahen uns über den Tisch hinweg an, mit einem Blick, der die gutwillig geheuchelte Familieneintracht zerschnitt. ‚Du hast doch bei uns gelebt‘, rief ich, ‚du musst es doch besser wissen …‘“
In einem entwaffnend direkten Stil, der von Dialogen und Details lebt, verbindet Reimann die Widersprüche der DDR mit dem Erbe des Dritten Reiches – diese Zonen oder Sektoren wurden von den Alliierten im Mai 1945 geschaffen –, anstatt zu beschönigen, was es bedeutete, aus kriegszerstörten Trümmern eine neue Gesellschaft zu schmieden. Als die Mutter der Geschwister sie bittet, den Streit zu beenden, verlässt Elisabeth das Restaurant und weint „ohne Tränen“ bis sie die Grenze erreicht: „In diesem Augenblick begriff ich, was das hieß: das gespaltene Deutschland.“ Sie will keine Teilung mehr, sie will nie wieder den schwankenden Tonfall ihrer Mutter hören, nie wieder einen Bruder aus ihrem Leben gehen sehen. Der 25-jährige Uli, ein frischgebackener Diplomingenieur, steht auf der schwarzen Liste, weil er für einen in den Westen geflohenen Professor gearbeitet hat. Welche Zukunft kann er in der DDR haben? Als er Elisabeth seinen Entschluss mitteilt, das Land zu verlassen, hat sie zwei Tage Zeit, ihn aufzuhalten. Ihre Überzeugungskraft ist begrenzt, aber sie hat Ressourcen: die Nähe zu ihrem Lieblingsbruder, das Wissen um ihre Kindheit während des Krieges und die Zeit danach, ihren Freund Joachim Steinbrink, der mit seinen 28 Jahren das Braunkohlewerk leitet, in dem sie arbeitet, und nicht zuletzt das immergrüne Ideal eines Staates, der von jedem nimmt, was er kann, und jedem gibt, was er braucht.
Reimanns eigener Bruder Lutz, der ihr altersmäßig am nächsten stand, ging im April 1960 mit Frau und Kind in den Westen. „Ich bin sehr traurig“, schreibt sie in ihr Tagebuch. Lutz war ein „Wirrkopf“, dessen Handlungen sie „prinzipiell“ verurteilte, aber er war ihr Bruder. „Ich liebe ihn, wir haben uns viele Jahre lang gut verstanden“, schrieb sie. Sie erkannte sofort das Potenzial der Geschichte für die Kunst: „Zerrissene Familien, Konflikte zwischen Brüdern und Schwestern – was für ein literarisches Thema! Warum nimmt sich niemand dieses Themas an, warum schreibt niemand ein aktuelles Buch? Furcht? Unfähigkeit? Ich weiß es nicht.“ Sie würde es tun, und der daraus resultierende Roman würde „so sein, wie die Dinge hätten laufen sollen, aber nicht gelaufen sind“. Reimann nahm den Namen ihres verbliebenen Bruders Uli für Elisabeths schwankendes Geschwisterchen und fügte Zeilen aus ihrer Korrespondenz mit Lutz – „Und ich habe einige Verräterkomplexe, wie man so sagt“ – in Konrads Briefe ein. Lutz war verärgert über den fertigen Roman, Uli und Reimanns jüngste Schwester Dorli waren begeistert.
„Für jeden Schriftsteller ist die Arbeit eine Selbstbefragung“, schrieb Reimann im Dezember 1959 in ihr Tagebuch, „und es scheint, dass gerade darin die Kunst liegt: diese Selbstbefragung allgemein interessant und einer möglichst breiten Leserschaft zugänglich zu machen.“ Reimann war kein Apparatschik. Sie war genauso neugierig darauf, ihre eigenen Erfahrungen festzuhalten wie jeder Künstler, aber sie hatte nicht die Freiheit, so zu schreiben, wie sie wollte. Sie konnte sich nicht einmal ihr Genre aussuchen.
Der sozialistische Realismus galt lange Zeit als kitschig, politisch und ästhetisch kompromittiert. Kunst, die unter diesen Bedingungen gemacht wird, lädt zu Spott ein: Kann man unter der Kontrolle eines Michail Suslow gute Romane schreiben? Aber Reimanns Werk zeigt, dass sie es können. Wie sie damals feststellte, steckte in der Forderung des Staates an seine Schriftsteller, einen neuen Kanon der sozialistischen Literatur zu schaffen, ein Kompliment. Die Parteifunktionäre waren der Meinung, dass es darauf ankommt, wer in den Romanen vorkommt, wie sie geschrieben sind und wie sie enden. Reimanns Talent wurde erkannt und genutzt: Sie erhielt ein Stipendium vom Schriftstellerverband und Buchverträge von den staatlichen Verlagen und wurde gebeten, den Arbeiterschreibkreis in der Brikettfabrik zu leiten. Dennoch trat sie nie in die Partei ein, und ihre Unzufriedenheit mit dem Staat wuchs immer mehr. Schon in den frühen 60er-Jahren schrieb sie über den Druck der Stasi, die Verlockungen des neonbeleuchteten Westens und das Leben in einem Regime, das Loyalität höher bewertete als Talent. Beim Lesen von „Geschwister“ kann man nostalgische Gefühle für eine Gesellschaft verspüren, die noch an die Bedeutung der Kunst glaubte.
In „Die Geschwister“ bringt Reimann die Vergangenheit so nahe, dass sie sich kaum vergangen anfühlt. Elisabeth erinnert sich an die Meißner Figuren, die ihre Mutter nach dem Krieg verkaufte, um sich Lebensmittel zu kaufen. Sie erzählt von der Freundin von Konrad, die versuchte, sie mit seltenen Taschenbüchern und französischem Lippenstift in den Westen zu locken. Schließlich reflektiert sie die Geschichte ihrer Auseinandersetzung mit einem älteren Maler, Ohm Heiners, der ebenfalls im Kohlekraftwerk arbeitete und die sie ihrem müden Bruder als Inspiration erzählte. Elisabeths Disput mit diesem Künstler der vorangegangenen Generation ist der Höhepunkt des Romans, in dem Argumente über den Wert der Kunst, über die Art der Wiedergutmachung für die unter Hitler Geschädigten und über die Art und Weise, wie der neue Staat für seine Arbeiter sorgen sollte, miteinander verbunden werden. Dieser Abschnitt in Kapitel 8 beunruhigte die Behörden, die erfolglos versuchten, ihn vor der Veröffentlichung zu streichen. Als der Roman 1963 erschien, akzeptierte Reimann einige kleinere Kürzungen, wehrte sich aber vehement gegen größere. 1969 überarbeitete sie den Roman selbst. Für die vorliegende Veröffentlichung im Jahr 2023 verwendeten die Herausgeberinnen Angela Drescher und Nele Holdack einen Entwurf der ersten fünf Kapitel, der bei Renovierungsarbeiten in der Wohnung in Hoyerswerda gefunden wurde, in der Reimann während ihrer Arbeit in der Kohlefabrik lebte.
Der Streit beginnt im Kaffeeraum der Fabrik. Heiners fragt Elisabeth, was sie von einem seiner Bilder hält, das in der Kantine hängt, und sie beschließt ehrlich zu sein. „Meine Brigade war nicht begeistert … Dein Bild ist schlecht“, sagt sie. „Du hast einen hirnlosen Produktioner gemalt … Ich kenne den Mann. Er hat nichts mit deinem finsteren Roboter zu tun.“ Heiners explodiert und versucht, Elisabeth zu diskreditieren, indem er sie „einen bürgerlichen Grünschnabel“ nennt, deren Vater Journalist unter Hitler war. Als Heiners, der von den Nazis mit Malverbot belegt worden war, einige Tage später ihr Atelier besucht, offenbar um die Wogen zu glätten, geht der Streit weiter: „Ein Arbeiter würde doch bloß lachen, wenn er deinen Lichtbogen sieht“, behauptet Heiners. „Mein Auge ist aber keine Kameralinse, und ich bin kein Fotoapparat, ich bin ein Mensch mit Empfindungen und mit einem bestimmten Verhältnis zu dem Menschen, den ich male, und dieser Mensch … hat seine Empfindungen und seine eigene Beziehung zum Leben, zu seiner Arbeit, zu sich und anderen, und das alles sollte in einem Porträt sein, viele Schichten statt einer glatten Fläche.“ Dann fordert Heiners sie auf, von ihrem hohen Ross herunterzukommen.
Ein Problem bei der Schaffung eines neuen ostdeutschen Kulturkanons war der Mangel an Vorläufern. Die Geschichte hatte 1949 mit der Gründung der DDR begonnen, sodass es nicht viel gab, worauf die Künstler aufbauen konnten. Der bedeutende marxistische Theoretiker György Lukács fand einen Weg, dieses Problem zu umgehen: Er argumentierte, die großen bürgerlichen Schriftsteller – darunter Balzac, Stendhal, Fontane und Zola – hätten die unlösbaren Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft erfasst und so deren Untergang aufgezeigt. Reimanns Lieblingsautor war Stendhal, auf den sie sich immer wieder bezog und den sie nie aufhörte zu lesen. Elisabeth plädiert für einen besonderen Realismus, der die eigene Sichtweise des Künstlers respektiert und sich die Freiheit nimmt, dem Subjektivismus nahe zu kommen.
Da Heiners die ästhetische Auseinandersetzung nicht gewinnen kann, greift er zu schmutzigeren Taktiken. Er streut Gerüchte, Elisabeth würde mit Mitgliedern ihres Malerzirkels schlafen. Er bezeichnet sie als „eine intellektuelle Nutte“, die „jeden Abend mit einem anderen ins Bett“ ginge. Heiners erzählt seinen Parteifreunden auch von Elisabeths Ansichten zur Malerei, was einen Besuch der Staatssicherheit nach sich zieht. „Es wird behauptet, Sie hätten in Ihrem Zirkel eine bürgerliche Fraktion gebildet“, sagt der Stasi-Mann, bietet ihr eine Zigarette an und bemerkt ihr Händezittern. „Wir sollten uns offiziell zusammensetzen.“ (Auch diese Szene hatten die Behörden zunächst unterdrücken wollen.) Elisabeth beschließt, sich zu wehren. Sie denkt, sie könne den Gerüchten durch ein Gespräch mit Bergemann, dem örtlichen Parteisekretär, entgegentreten. Spät in der Nacht geht sie in seine Wohnung, um ihm ihre Schilderung der Vorkommnisse zu geben. Sie findet „Anna Karenina“ und „Der Zauberberg“ sowie ein Selbstporträt von Henri Rousseau an der Wand. „Wunderbar ermutigt“ von Rousseaus bärtigem Gesicht, weiß sie plötzlich, wie sie Bergemann überzeugen kann. Sie zeigt ihm die Porträts, die sie von den Arbeitern im Werk gemacht hat. „Ich verstehe nicht genug von der Malerei“, sagt Bergemann und betrachtet ihre, aber „ich kann nur sagen: Das ist nützlich, das ist schön, das gefällt mir … Es kommt in der Kunst darauf an, das Wesen der Dinge darzustellen.“ Als Heiners im Büro des Parteisekretärs hinter einer lederbezogenen Tür mit seinem Verhalten konfrontiert wird, wirft er seinen Parteiausweis über den Schreibtisch und verlässt seinen Posten in der Fabrik.
Diese fiktive lederbezogene Tür passt zu anderen Erinnerungsstücken aus der DDR. In den Büros des Ministers für Staatssicherheit in Berlin, die heute als Teil eines Museums erhalten sind, stehen drei Telefone auf einem Holzschreibtisch. Sie warteten darauf, Gerüchte weiterzugeben, die jemanden das Leben erschweren konnten. In der Leipziger „Runden Ecke“, der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit im früheren Bezirk Leipzig, steht eine Maschine, die Akten kreuzweise zerkleinert und mit Klebstoff vermischt. So entstehen grobe, graue Ziegel, die den Rohinhalt für immer unlesbar machen.
Trotz so vieler Verluste – eines Bruders, einer Zukunft, einer Ideologie – haben Reimanns „Geschwister“ irgendwie überlebt, ein ungewöhnliches Stück politischer, persönlicher und ästhetischer Freiheit.