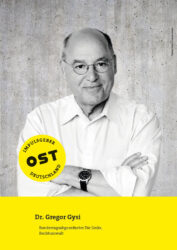Das Netzwerk der gemeinnützigen Initiative DenkRaumOst hat es sich zum Ziel gesetzt, den Charme Ostdeutschlands sichtbar zu machen. In Teil fünf ihrer Kolumne plädiert Prof. Dr. Thomas Brockmeier dafür, den Osten mit seinen heutigen Potenzialen neu zu sehen – und innerhalb Deutschlands endlich fair zu bilanzieren.

Prof. Dr. Thomas Brockmeier ist seit 2011 Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau und lehrt seit 2005 Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Wirtschaftspolitik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Abbildung: IHK Halle-Dessau
Ostdeutschland ist ein vitaler und attraktiver Standort zum Leben und Arbeiten. In einer Kolumne kann diese These bestenfalls kursorisch gestützt werden. Exemplarische Schlaglichter dienen der Illustration, Anspruch auf „Vollständigkeit“ wird nicht erhoben …
Ostdeutschlands Trümpfe
Ostdeutschland kann bei vielen Standortfaktoren punkten: Wer größere Flächen für Industrie und Gewerbe sucht, wird hier fündig. Junge Familien können sich den Traum von der eigenen Wohnimmobilie erfüllen, denn Baugrundstücke und Bestandsimmobilien sind noch immer recht günstig, die Lebenshaltungskosten im Durchschnitt niedriger. Umfang, Verlässlichkeit und Preise für die Kinderbetreuung lassen „Bedürftige“ im Westen vor Neid erblassen. Die Infrastruktur in Schiene und Straße ist insgesamt sehr gut ertüchtigt worden, das DHL-Frachtdrehkreuz am Flughafen Leipzig/Halle ist ein Trumpf. Der Auf- und Ausbau der Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen kann sich sehen lassen. Großforschungszentren wie das CTC in Delitzsch und Merseburg lassen innovative Impulse für eine (noch) grünere Chemie und kohlenstoffbasierte Kreislaufwirtschaft erwarten. Die Gründung des Deutschen Lithium-Instituts und das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation in Halle (Saale) setzen Zeichen. Und sollten wir bei den „Erneuerbaren Energien“ effektiv und effizient ohne zu große Flurschäden vorankommen, kann daraus gerade für den Osten ein neuer Standortvorteil werden. Hinzu kommt die Vielzahl naturräumlicher bzw. landschaftlicher Perlen und das noch immer dichte Netz von Kultureinrichtungen wie Museen, Theater und Orchester, deren Tradition weit vor die Nationalstaatsidee zurückreicht. Die Vielfalt und Qualität der Angebote von Theatern wie etwa jenem der Lutherstadt Eisleben oder auch der Philharmonie Gotha Eisenach stehen denen weit größerer Städte nicht nach. Die Wiege der deutschen Kultur liegt im Osten.
Dies alles wirkt: Neuansiedlungen großer Unternehmen haben weit mehr als nur jene anekdotische Evidenz, die oft mit Tesla in Grünheide verbunden wird: UPM aus Finnland baut in Leuna die weltweit erste Bioraffinerie, Daimler Trucks investiert in Halberstadt, CATL aus China baut eine Batteriefabrik in Arnstadt, TSMC kooperiert mit Bosch, Infineon und NXP, um in Dresden eine Chipfabrik zu errichten. Und ob Intel nun tatsächlich nach Magdeburg kommt oder nicht – die Basisentscheidung hat gezeigt, dass Sachsen-Anhalt und Ostdeutschland auf der Weltkarte der Standortentscheidungen präsent sind. Der damalige Intel-Chef Pat Gelsinger begründete seine Entscheidung so: „Sicher gab es auch andere gute Standorte. Aber Magdeburg und Sachsen-Anhalt wollten unbedingt, sie waren hungriger.“
Dieser „Hunger“ ist ein weiterer Standortvorteil: Die Menschen in Ostdeutschland sind nicht verwöhnt oder gar saturiert. So jedenfalls nehme ich als „Wossi“ das wahr. Hier wird noch immer länger gearbeitet, und die Bereitschaft zu bisweilen nötiger Mehrarbeit ist groß. Die Industrie genießt hohe Akzeptanz. Bei näherem Hinsehen kein Wunder: Wer Freiheit erhofft, ersehnt oder sogar erkämpft hat, wer Wohlstand nach Strukturbrüchen und hoher Arbeitslosigkeit in der kurzen Zeitspanne einer einzigen Generation erarbeitet hat, der schätzt dies alles mehr, als wenn er einfach hineingeboren wurde. Wer erlebt hat, dass die gewohnte eigene Welt plötzlich nicht mehr existiert, dass Bewährtes nicht(s) mehr gilt, dass Erlerntes und Erreichtes quasi über Nacht entwertet werden können, der spürt sehr genau, ob und wann etwas auf dem Spiel steht. Viele Ostdeutsche sind „Freiheits-Seismographen“.
Aufbau Ost hat sich für den Westen gerechnet
Diese oft betonte „Transformationserfahrung“ im Osten kann als weiterer Standortvorteil durchgehen: Krisenerprobte halten nun mal länger durch. Im Übrigen mussten jene, die als Unternehmer zusammen mit ihren Mitarbeitern Schritt für Schritt Marktanteile eroberten, dies zunächst oft gegen erfahrene Konkurrenten aus Westdeutschland schaffen – eine Art „Exportleistung“ im eigenen Land also. Zudem mussten sie dies quasi als „Zurückgebliebene“ tun, hatten doch viele junge und gut ausgebildete Menschen in den frühen 1990er-Jahren ihr Glück durch Abwanderung in den Westen gesucht. Der „Aufbau Ost“ vor Ort musste also ohne sie stattfinden.
Aus gesamtdeutscher Perspektive jedoch haben diese „Auswanderer“ durchaus zum Aufbau Ost – und zugleich sogar zu einem „Aufbau West“ – beigetragen. Durch ihre dort erbrachte Wertschöpfung nämlich. Bei circa 50.000 Euro je Arbeitskraft und Jahr ergibt sich für die etwa zwei Millionen Abgewanderten „drüben“ ein Wertschöpfungsbeitrag von rund 100 Milliarden Euro. Jährlich! Damit wäre der „Solidarpakt II“, der 300 Milliarden D-Mark umfasste (156 Milliarden Euro), rechnerisch also in nicht einmal zwei Jahren allein von jenen Menschen erwirtschaftet worden, über die sich der Westen ohne die Einheit niemals hätte freuen können. Und in Zeiten akuten Fachkräftemangels ist dies ein Pfund, mit dem gerade heute gewuchert werden kann. Höchste Zeit also, den im Westen mitunter noch heute beklagten „Sonderlasten“ der deutschen Einheit auch „Sondererträge“ gegenüberzustellen. Eine Bilanz hat nun mal zwei Seiten – immer, also auch für Deutschland.
| Die nächsten Live-Termine von DenkRaumOst |