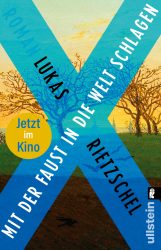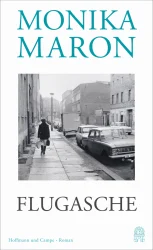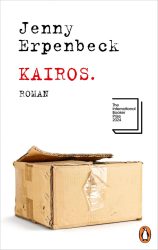Im fünften Teil seiner Kolumne widmet sich Dr. Tobias Lehmann dem Roman „Die Möglichkeit von Glück“ von Anne Rabe. Ein Buch über politische Folgen, eine Gesellschaft im Umbruch, über Familien, die schweigen, und Kinder, die dieses Schweigen irgendwann nicht mehr ertragen.

Dr. Tobias Lehmann hat an der University of Oregon zum Thema Wendeliteratur promoviert. Geboren 1981 in Eisenhüttenstadt war er lange Zeit in Südkorea und anschließend in den USA tätig.
Obwohl das Buch als Roman bezeichnet wird, liest es sich wie ein autobiografischer Bericht mit einer Ich-Erzählerin und einer Mischung aus persönlicher Geschichte, historischem Material und Reflexionen über die DDR. Die Erzählerin Stine wurde 1986 geboren, genau wie die Autorin. Sie war drei Jahre alt, als die Mauer fiel und das sozialistische Regime zusammenbrach. Sie wurde in einer historischen Zäsur geboren – einem Wendepunkt in der Geschichte. Dieses Buch handelt maßgeblich davon, wie sich das für sie auswirkte.
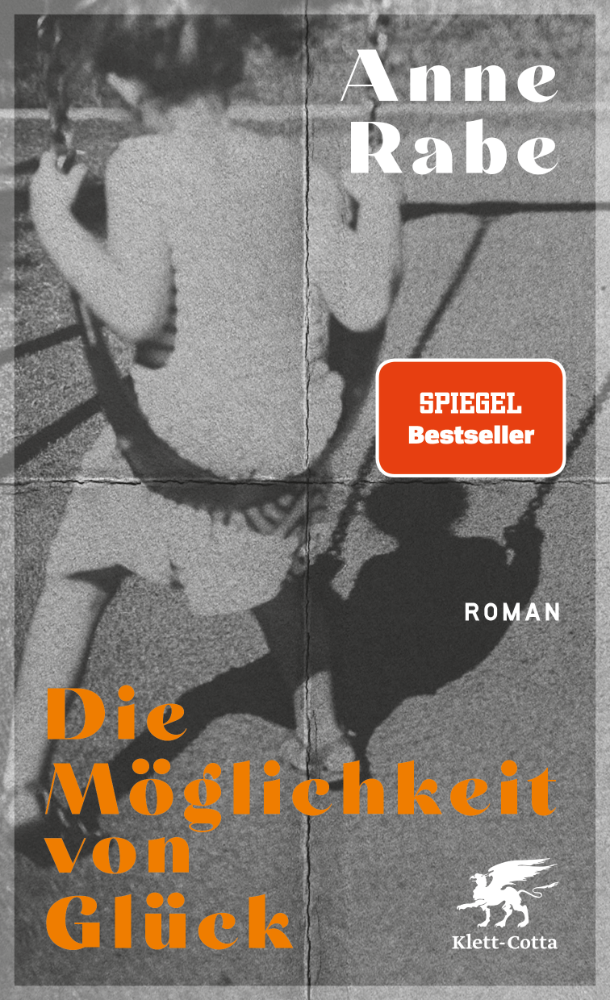
Anne Rabes „Die Möglichkeit von Glück“ ist im Klett-Cotta-Verlag erschienen.
Die Ich-Erzählung hat zwei Hauptstränge: Zum einen Stine als Tochter, die sich entscheidet, die Beziehung zu ihrer misshandelnden Mutter abzubrechen und ihre eigene Tochter Klara außerhalb des Elternhauses aufzuziehen. Zum anderen bekommt Stines Leben als Schriftstellerin Bedeutung, die die wahre Geschichte der Karriere ihres Großvaters Paul unter dem Nationalsozialismus und der SED untersucht. Diese Handlungsstränge sind durchsetzt mit Poesie und journalistischen Reflexionen über verschiedenste Aspekte der ostdeutschen Gesellschaft, von den Nachwirkungen des Jahres 1989 bis in die heutige Zeit.
Der Roman taucht direkt in eines seiner eindringlichsten Themen ein: Stines Beziehung zu ihrer Mutter – aus der Sicht einer jungen Frau, die jetzt ihr eigenes Baby hat. Stine hat ihre Mutter um Rat gefragt, wie man mit einem schreienden Baby umgeht, denn es kommt ihr so vor, als würde ihr kleiner Sohn Kurti schon seit drei Monaten weinen. „Ach, Tim war auch so“, sagt ihre Mutter fröhlich, „und wir haben ihn einfach weinen lassen.“ Stine erinnert sich daran, wie verzweifelt und verlassen ihr kleiner Bruder war, als niemand zu ihm kam. Das ist nur der Einstieg in das Verhalten ihrer Mutter.
Die kleineren Grausamkeiten, die sie im ersten Teil des Buches an den Tag legt, wirken wie die einer Frau, der es an Mitgefühl und Empathie mangelt: ihre Weigerung, die kleine Stine zum Arzt zu bringen, ihr Bestehen darauf, dass die Kinder im eisigen April Sandalen ohne Socken tragen. Doch es kommt zu einer Eskalation der körperlichen Gewalt: zu Kopfnüssen und Schlägen und schließlich zu einer wirklich schrecklichen Schilderung des Verbrühens, die man nur als sadistisch bezeichnen kann.
Es überrascht nicht, dass Stine so schnell wie möglich von zu Hause auszieht, um in Berlin zu studieren. Das Verhältnis zu ihren Eltern ist gespannt. Als sie den positiven Schwangerschaftstest sieht, denkt sie zuerst: „Gott sei Dank, jetzt muss ich zu Weihnachten nicht nach Hause.“ Als ihre Mutter anfängt, die Jugendweihe ihrer Tochter Klara zu planen, lehnt Stine dies ab. Klara werde weder eine Jugendweihe feiern noch geschlagen werden. Ihre Mutter rastet aus und beschuldigt Stine der Lüge, woraufhin Stine den Kontakt abbricht. Es ist jedoch nicht so leicht, die Auswirkungen der Grausamkeit ihrer Mutter abzuschütteln – und die Mittäterschaft ihres Vaters, der wenig unternimmt, um sie aufzuhalten. Stine leidet unter Albträumen und Selbstmordgedanken, besonders als sie von ihrem Bruder Tim erfährt, dass ihre Mutter sie nun als psychisch krank einstuft und sich Zugang zu ihren Enkeln Klara und Kurti wünscht, um sie vor ihrer labilen Mutter zu schützen.
Stines Geschichte scheint eine lineare Erzählung zu sein, was sie aber in Wirklichkeit nicht ist. Von Anfang an wird Stines persönliche Geschichte mit dem Kontext der ostdeutschen Gesellschaft durchsetzt. Stines Eltern waren Mitglieder der SED, der Regierungspartei in der DDR. Es wird erwähnt, dass sie nach 1989 und der Wende der PDS, der Nachfolgepartei der SED, beitraten und dann die PDS verließen, wobei die Chronologie nicht klar ist. Es genügt zu sagen, dass in der kleinen Stadt an der Ostsee, in der Stine aufwächst, bekannt ist, dass ihre Familie in der SED war. Ihre ehemalige Schulfreundin Ada, deren Eltern in der Dissidentenbewegung im Umfeld der evangelischen Kirche aktiv waren, erzählt ihr, dass sie sie gehasst haben, als Stine ein Kind war.
Doch über diese Spaltungen, die noch lange nach der Einheit bestanden, wurde nicht offen gesprochen. Tatsächlich beklagt die erwachsene Stine, dass Deutschland sich zwar seiner Nazi-Vergangenheit stellt, es aber keine vergleichbare Aufarbeitung der Verbrechen des totalitären SED-Staates gegeben hat. Stattdessen herrschten Schweigen und Untätigkeit vor und innerhalb der Familie wurden – wie so oft in Diktaturen – die Missbrauchserfahrungen geleugnet.
Schon zu Beginn des Romans erfahren wir von Stines Beziehung zu ihrem Großvater Paul, dem Vater ihrer Mutter. Er ist inzwischen alt und hat sein Augenlicht verloren. Er genießt es, mit seiner kleinen Enkelin an der Küste spazieren zu gehen und ihr Fragmente seiner Lebensgeschichte zu erzählen, die oft mit dem Nachkriegsspruch „Nie wieder Faschismus! Nie wieder Faschismus!“ enden. Die junge Stine weiß, dass Opa Paul und Oma Eva Mitglieder der SED waren. Aber erst als Erwachsene, fast als Reaktion auf den Bruch mit ihren Eltern, beschließt Stine nachzuforschen, welche Rolle Paul in der DDR spielte. Ihre erste Anlaufstelle ist seine Akte in den Stasi-Archiven. Sie erinnert sich daran, dass Paul gesagt hat, er habe sie gesehen, und ist daher überrascht, als sie erfährt, dass sie nicht vorhanden ist. Hat er sie in dem Zeitfenster, in dem das möglich war, entfernt und vernichtet? Nach hartnäckigen Nachforschungen und Bemühungen findet sie weitere Unterlagen und setzt sein Leben zusammen, das sie gegen Ende des Romans in vier Abschnitten schildert.
Rabe schreibt aus einer frischen und originellen Perspektive, erschafft gut entwickelte, glaubwürdige Charaktere und schreckt auch vor moralischer Komplexität nicht zurück. Die fragmentarische Struktur des Romans wird sehr wirkungsvoll eingesetzt und führt zu einem zunehmenden Gefühl der Spannung während der gesamten Erzählung. In einer zutiefst schockierenden Episode werden die Protagonistin und ihr Bruder von ihrer misshandelnden Mutter gezwungen, ein unerträglich heißes Bad zu nehmen. Die Art des mütterlichen Missbrauchs wurde bis zu diesem Punkt des Romans größtenteils nur angedeutet, sodass diese Sequenz eine gewalttätige und zutiefst erschütternde Enthüllung ist – eine, die den Leser noch lange nach der Lektüre des Buches verfolgt.
Der Schluss ist versöhnlich. Das Buch endet damit, dass Stines Kinder eine Partie Schlagball spielen, bei der Wärme, Zärtlichkeit und Spaß im Vordergrund stehen, und es entsteht ein Gefühl des Optimismus, ein Versprechen auf neue und liebevolle Familienbeziehungen für diese Generation. Es scheint, als hätten Stines Nachforschungen und ihre ehrliche Einschätzung von Großvater Paul es ihr ermöglicht, sich mit der dunklen Seite der Geschichte ihrer Familie und ihres Landes auseinanderzusetzen. Damit können sie und ihre Kinder nun weitermachen und in die Zukunft blicken.
Dieser Roman ist eine überzeugende literarische Repräsentation über das Aufwachsen in einer Familie und in einer Gesellschaft, die aus einer Diktatur hervorgegangen ist. Es gibt jedoch auch Wiederholungen und einige Berichte über das Leben als Teenager, in denen die Erzählung ein wenig nachlässt. An anderen Stellen hätte ich gern mehr erfahren: Was waren diese Wochenkrippen und warum findet Stine sie so schrecklich? Obwohl ich nichts gegen wechselnde Zeitebenen habe, waren die Wechsel hier manchmal etwas zu verwirrend.
Rabes preisgekrönte Talente als Dramatikerin, Drehbuchautorin und Essayistin kommen in diesem außergewöhnlichen Werk der Literatur zum Tragen, das auf der Short-List des deutschen Buchpreises 2023 stand. „Die Möglichkeit von Glück“ ist eine einzigartige literarische Leistung, in der sich verschiedene Formen des Schreibens zu einem nuancierten und beunruhigenden Werk verbinden, das ebenso gelehrt wie fesselnd ist.