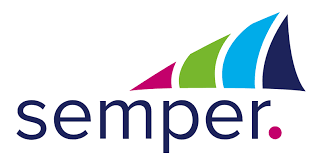Katja Dietrich, Oberbürgermeisterin von Weißwasser/Oberlausitz, ist eine wichtige Impulsgeberin für Ostdeutschland. Sie setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist sie auch im zweiten Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.

Katja Dietrich, Oberbürgermeisterin Weißwasser/Oberlausitz. Abbildung: Tine Jurtz
Ich bin in den Baseballschlägerjahren groß geworden. Junge Neonazis mit Springerstiefeln und Bomberjacke in jeder Straßenbahn, im Stadtbild, in der Schule. Die Großdemonstrationen der Neonazis jeden 13. Februar in Dresden und dieses Bild des brennenden Gastarbeiterblocks in Rostock-Lichtenhagen mit dem Deutschen mit Urin auf seiner Hose, Deutschlandtrikot und rechter erhobener Hand – das wird mir nie aus dem Kopf gehen. Da war ich elf Jahre alt. Ich habe als Kind, als Teenager nie verstanden, wie man Menschen hassen kann, die man nicht einmal kennt. Und verstehe es heute immer noch nicht.
Ich bin 1980 in Dresden geboren und aufgewachsen – bis zum Abi. Zum Studieren bin ich nach Aachen gegangen. Nicht weil ich vom Osten wegwollte, sondern weil ich einfach etwas anderes sehen wollte. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich, wenn ich in den alten Bundesländern aufgewachsen wäre, im Osten studiert hätte.
Als Ossi empfunden habe ich mich in Aachen erst durch meine westdeutschen Kommilitonen. Niemand, den ich vorher kannte, besaß ein Haus oder eine Wohnung, geschweige denn eine Finca von der Oma in Spanien, wo man einfach mal zum Urlaub hinflog, auch wenn man als Student kein Geld hatte. Oder Eltern, die Putzfrauen zu Hause hatten! Unglaublich für mich damals.
Wenn wir scheitern, dann nicht daran, dass wir weniger Geld haben. Sondern daran, dass wir verlernt haben, Toleranz zu leben.”
Blick aus der Welt auf die Heimat
Nach meinem Studium bin ich als Entwicklungshelferin drei Jahre nach Malawi gegangen, danach war ich sechs Jahre bei UN-Habitat in der Zentrale in Nairobi, Kenia und dann drei Jahre im Irak für den Wiederaufbau. Ich wollte die Welt nicht nur sehen, sondern wirklich erleben und verstehen. Und ja, so abgedroschen wie das klingt: Ich wollte und will Gutes tun und dazu beitragen, dass es Menschen auf dieser Welt besser geht.
In der internationalen Arbeit ist mir der Vorteil des Aufwachsens im Osten und das Erleben zweier Systeme erst richtig bewusst geworden. Diese Erfahrung und der Umgang mit vielen anderen Lebensrealitäten haben mich viel offener gemacht, auf Menschen zuzugehen, mich neuen Situationen auszusetzen, auch ungewöhnliche Ansätze in Betracht zu ziehen und den Mut für Veränderungen zu haben. Dabei ist mir klar geworden, dass es oft kein „Besser“ oder „Schlechter“ gibt, sondern nur ein „Anders“.
Die Erfahrung aus dem Osten, dass von einem auf den anderen Tag alles anders sein kann, ist mir in verschiedenen Ländern innerhalb meines Jobs bei den Vereinten Nationen oft begegnet. Im Irak war dies auf die Spitze getrieben: Es gab gefühlt jeden Monat eine große Änderung, auf die ich mich selbst und mein Projektteam einstellen musste. Das hat mich widerstandsfähig gemacht, ruhiger, aber ich weiß auch, dass das auf lange Sicht ermüdend sein kann.
Was ich auch mitgenommen habe: wie hart die Welt da draußen ist, und wie glücklich wir sein dürfen, ein so tolles Land und ein so tolles Europa über Generationen aufgebaut zu haben. Wir sind die glücklichen Ausnahmen in der Welt. Die Werte der Demokratie und Freiheit gilt es zu verteidigen. Und damit meine ich nicht Krieg, sondern die Erkenntnis, dass dies immerwährende Arbeit ist. Es geht darum, wie wir in unserer Gemeinschaft miteinander umgehen, wie wir uns einbringen, wie wir Konflikte angehen, wie wir Unterschiede aushalten.
Dies hilft mir auch ungemein in meiner jetzigen Position als Oberbürgermeisterin in Weißwasser. Einer Stadt in der Lausitz, strukturschwach, wie man sagt, und voll vom Kohleausstieg betroffen, der Wirtschaft und Gesellschaft durchrüttelt.

Die Waldeisenbahn Muskau ist eines der wichtigsten touristischen Ausflugsziele in Weißwasser und der Region. Abbildung: Maria Hommelsheim
Leben von Veränderung
Mir war es ein inneres Bedürfnis, nach 20 Jahren Studium und Arbeit außerhalb Ostdeutschlands wieder nach Hause zu kommen, nach Sachsen. Auslöser dafür waren Erlebnisse: 2015 saß ich in einem Taxi in Nairobi und im Radio kam ein Bericht über die Pegida- Demonstrationen in Dresden. Mein Taxifahrer fragte, was da los ist, und ich konnte es ihm nicht erklären. Ich brachte es nicht einmal fertig, ihm zu sagen, dass das meine Heimatstadt ist. Seitdem beschäftigte ich mich wieder mit meinem Sachsen. Als ich 2019 mit meinen internationalen Kollegen in Bagdad die Wahlergebnisse zur Landtagswahl in Sachsen verfolgte, war ich weit besser gerüstet für Antworten. Ich hatte die Ohnmächtigkeit gegenüber „denen da oben“, den Verlust der Glaubwürdigkeit, den Frust und das Misstrauen verstanden. Nur die Kanalisierung dieser Emotionen in so eine Partei kann ich bis heute nicht vollständig nachvollziehen. Das Ergebnis erschreckte mich. Aber mindestens ebenso verwunderte mich die fehlende Einsicht der Amtsträger in die Notwendigkeit, Dinge endlich offen auszusprechen, anzugehen und offensichtliche Schmerzpunkte als Priorität zu behandeln – nicht nur auf Landesebene. Ich habe mit meinem Außenblick nicht verstanden, warum man das Wohnungsproblem in Großstädten nicht angeht, die Bildungspolitik und den Stand der Schulgebäude, ganz zu schweigen von der Digitalisierung. Andererseits hat es mich aber auch gewundert, wie wenig die Deutschen demonstrieren und wo, wie und wann dieser Dialog zwischen Bürgern und Politik stattfinden kann.
Diese Gemengelage ließ mich zurückgehen. Ich wollte meinen Beitrag leisten. Ich konnte bei der Sächsischen Agentur für Strukturentwicklung (SAS) den herausfordernden Prozess des Kohleausstiegs ein Stück mit begleiten. Hier in der Lausitz, in Nordostsachsen, stand der nächste große Bruch, die nächste massive Veränderung, der nächste Wechsel an. Mit der SAS und den Fördermillionen soll diesmal der Prozess geplanter, strategischer und erfolgreicher ablaufen. Kein Zusammenbruch, wie in der DDR, sondern eine Zukunft soll entstehen.

Da das jährliche Aufstellen des städtischen Weihnachtsbaums nicht mehr finanzierbar war, wurde einfach einer gepflanzt. Abbildung: Maria Hommelsheim
Zusammenhalt für die Zukunft
Seit November 2024 bin ich Oberbürgermeisterin von Weißwasser und trage die Verantwortung für die Zukunftsgestaltung meiner Kommune. Nun muss ich meinen eigenen Ansprüchen an Transparenz, Kommunikation und Wahrheit genügen. Da mir diese Dinge wichtig sind, fällt es mir relativ leicht, dies anzugehen. Ich merke aber auch, wie Wahrheiten unserer Stadtgesellschaft natürlich auch weh tun und in dieser Zeit der Transformation Bürger an ihre Grenzen bringen, offen über Anpassungen und andere Wege zu reden.
Ich wünsche mir den Mut der Generation meiner Eltern zurück, die für uns auf die Straße gegangen sind – für eine andere Zukunft, auch wenn sie nicht richtig wussten, was kommen würde. Ich bin sehr stolz auf diese Generation, auch wie sie sich in den 1990er-Jahren durchgebissen hat. Meine Eltern und die meiner Freunde haben es uns nie spüren lassen, wie schwierig zeitweise die Lage war.
Ich wünsche mir für uns Ossis mehr Selbstvertrauen durch die Erfolge der letzten 35 Jahre. Und ich wünsche uns, dass wir verstehen, dass uns diese Transformationserfahrung durch diese derzeit schwierigen Zeiten führen wird. Das passiert aber nicht von allein. Es ist Zeit für meine Generation, aufzustehen und anzupacken. Ein Systemsturz ist keine Option – Demokratie ist das Beste, was es gibt. Aber wir müssen sie so gestalten und weiterentwickeln, dass sie zu uns und den Herausforderungen der Zeit passt. Und das ist nicht nur eine Aufgabe für „die da oben“, das fängt bei uns an.

Nach dem Ende des Kohlekraftwerks Boxberg wird an einer neuen Wärmeversorgung mit Kommunen und Unternehmen gearbeitet. Abbildung: privat
Ich denke, dass uns dabei der Pragmatismus und die Ehrlichkeit des Ostens helfen, welche die Kraft haben, jegliche Bürokratie zu sprengen und Dinge eben anders zu machen. Damit müssen wir als Gesellschaft aber auch verantwortungsvoll umgehen. Draufzuschlagen und Dinge kaputt zu machen – wie es hier und da derzeit Mode zu sein scheint – ist keine Lösung. Vielmehr gilt es, wenn Dinge nicht mehr funktionieren, dies auf allen Seiten einzusehen und gemeinsam Wege und Strategien zu entwickeln.
Aber wenn es ums Geld geht, merke ich, dass ich im Osten bin. Der Osten hat oft keinen doppelten Boden. Es gibt keine Immobilien, die man verkaufen kann, keine Aktien, keine privaten Rentenersparnisse. Meine Kommune kann kaum Geld bei der Vereinsunterstützung sparen, weil wir nur das Minimum ausgeben. Es muss eher darüber nachgedacht werden, wie wir dies allgemein anders aufstellen. Bei uns ist das keine Verzichtsfrage, bei uns ist das eine Existenzfrage.
Ich bin dennoch der Meinung, dass wir nicht daran scheitern werden, zu wenig Geld zu haben. Wenn wir scheitern, dann daran, dass wir nicht zusammenstehen.

Die DDR und die Banane – die Südfrucht war nicht nur für Katja Dietrich etwas Besonderes. Abbildung: privat
DDR-Ideen als Inspiration für die BRD
Ich wünsche mir keine Vergangenheitsverklärung. Aber die guten Dinge der DDR können neu belebt werden: Kinderbetreuung, Ganztagsschulen, Freizeitangebote für Kinder, Polikliniken, ein gemeinsames solidarisches Rentensystem. Und ich bin dem Osten dankbar für sein modernes Frauenbild und die Gleichberechtigung, in welcher ich aufwuchs. In der DDR hat man Frauen einfach zugetraut, in jedem Bereich des Arbeitslebens einen genauso wertvollen Beitrag zu leisten wie Männer. Es gibt insbesondere im Osten keinen Grund, sich als Frau zu verstecken. Das zeigt sich auch beim Blick auf Führungspositionen in unserer Stadt oder in der Lausitz, mit mehreren Frauennetzwerken in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die auch mich gestärkt haben. Und noch etwas ist im Rückblick wertvoll: Ich bin mit wenig Spielzeug aufgewachsen, mit einem Schwarzweiß-Fernseher, mit kleinen Urlauben – aber mit unheimlich vielen Kindern zum Spielen, mit Arbeitsgemeinschaften in der Schule, mit viel Gemeinschaft und Gemeinsinn. Das wünsche ich mir für unsere Kinder.
Und bezogen auf alle Menschen in Weißwasser hoffe ich, dass uns der Druck der Herausforderungen wieder enger zusammenschweißt. Denn durch Druck entstehen Diamanten.

Im Rahmen ihres Jobs bei den Vereinten Nationen hat Katja Dietrich viele Gegenden bei deren Entwicklung begleitet. Abbildung: privat
Katja Dietrich
GEBOREN: 1980/Dresden
WOHNORT (aktuell): Weißwasser/O.L.
MEIN BUCHTIPP: Jeannette Gusko: „Aufbrechen: Warum wir jetzt Menschen brauchen, die große Umbrüche bewältigt haben“, 2023
MEIN FILMTIPP: „Sonne und Beton“, 2023
MEIN URLAUBSTIPP: Paddeln im Spreewald
 BUCHTIPP: BUCHTIPP:
„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Auch dieser zweite Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die weiteren 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Band 2, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2025, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |