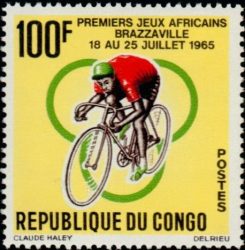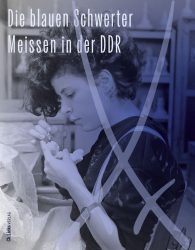Nordkorea mit der DDR zu vergleichen macht auf den ersten Blick wenig Sinn. Dr. Tobias Lehmann findet, ein Vergleich drängt sich dennoch auf. Denn ein paar Parallelen gibt es schon.

Im Rahmen seines DDR-Besuchs traf Kim Il Sung am 1. Juni 1984 Erich Honecker im Palast der Republik. Abbildung: Bundesarchiv, Bild 183-1984-0601-041 / Mittelstädt, Rainer / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE
Die DDR war im Vergleich zu Nordkorea sehr offen, zumindest einige Menschenrechte waren gewährleistet. In der DDR gab es ein minimales wirtschaftliches Versorgungssystem, in dem die Einwohner durch Arbeit ein Gehalt erhielten, Lebensmittel kaufen und sogar sparen konnten.
Im Gegensatz dazu ist Nordkorea ein Land, in dem das Gehalt nicht ausreicht, um zu überleben. Ein Arzt kann sich von seinem Monatslohn nur eine Kugel Eis kaufen. Das Land muss seinen Bürgern alle lebensnotwendigen Güter zur Verfügung stellen, da das Leben sonst nicht möglich wäre. In den frühen 1990er-Jahren brach die Versorgung plötzlich zusammen, was zu Millionen von Hungeropfern führte.
Zudem konnten DDR-Rentner in die BRD reisen und Briefe mit Westdeutschland austauschen, auch wenn diese oftmals von der Stasi kontrolliert worden sind. Im Gegensatz dazu sind Nord- und Südkorea immer noch im Kriegszustand, und jeder Versuch, Kontakt mit dem feindlichen Staat aufzunehmen, auch mit Verwandten, verstößt gegen das nationale Sicherheitsgesetz. Viele getrennte Familien vermissen einander seit mehr als 70 Jahren. Viele sterben, ohne ihre Verwandten jemals wiedergesehen zu haben.
Eine Nordkoreanerin, die über China nach Südkorea geflüchtet ist und in Berlin wohnt, empfindet jedoch Gemeinsamkeiten mit Ostdeutschen, sodass sie gern mit ihren ostdeutschen Kollegen plaudert: „Obwohl wir aus unterschiedlichen Altersgruppen und Hintergründen kommen, haben wir aufgrund unserer Erfahrungen im kommunistischen System eine gemeinsame Verbindung und können heute über manches zusammen lachen.“
Bilaterale Beziehungen und Aufbauhilfe für Hamhung
Auch auf der politischen Ebene gab es Gemeinsamkeiten. Die weit entfernten kommunistischen Cousins Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) und DDR verband während des Kalten Krieges einiges. Beide Länder waren kurz zuvor Opfer von Flächenbombardements geworden, beide waren Teil eines nach Kriegen gespaltenen Landes, beide hatten auf internationaler Ebene nur wenige Freunde und waren auf der Suche nach neuen. Die DDR erkannte Nordkorea 1949 an, fast unmittelbar nach ihrer Gründung und noch vor Ausbruch des Koreakrieges: „Die demokratischen Kräfte Deutschlands fühlen sich dem koreanischen Volk besonders verbunden, das wie das deutsche Volk für die nationale Einheit und die Anerkennung seiner Rechte auf internationaler Ebene kämpft“, schrieb der damalige Außenminister der DDR Georg Dertinger an seinen nordkoreanischen Amtskollegen, als die Beziehungen formell aufgenommen worden sind.
Die beiden Länder kooperierten während des Kalten Krieges in unterschiedlichem Maße. Nirgendwo war dies deutlicher als in der Hafenstadt Hamhung, Nordkoreas zweitgrößter Stadt nach der Hauptstadt Pjöngjang. Während des Koreakriegs wurde die Stadt durch die Bomben der USA fast dem Erdboden gleichgemacht, eine Geschichte, die in ostdeutschen Städten wie Dresden sicherlich Anklang fand. „Die DDR investierte daraufhin Millionen, um alles wieder aufzubauen“, sagte Bernd Stöver, Geopolitik-Historiker an der Universität Potsdam, einmal gegenüber der Deutschen Welle. „Sie schenkte Nordkorea praktisch eine sozialistische Stadt.“ Ein Team ostdeutscher Ingenieure, Architekten und Bauspezialisten wurde entsandt und arbeitete zwischen 1954 und 1962 in Hamhung. Nach Beobachtungen der ostdeutschen Botschaft schritten ihre Arbeiten so gut voran, dass ein Teil der Ressourcen und Arbeitskräfte später nach Pjöngjang umgeleitet wurde, um sicherzustellen, dass Hamhung die Hauptstadt nicht in den Schatten stellte.
Aber es gab auch einige Gegensätze zwischen den beiden kommunistischen „Bruderländern“. Sie wurden zum Beispiel bei einem Staatsbesuch von Kim Il Sung in der DDR deutlich. Kim besuchte 1984 die DDR, wo ein bilaterales Kulturfreundschaftsabkommen unterzeichnet wurde – ein Prozess, der mit Honeckers Besuch in Nordkorea 1977 begonnen hatte. Kim soll von den deutschen Fortschritten in Technologie und Informatik sehr beeindruckt gewesen sein und äußerte Interesse an einer vertieften Zusammenarbeit in Bildung und Forschung. Im Laufe der Jahre wurde ein stetiger Strom nordkoreanischer Studenten an DDR-Universitäten geschickt. Aber dies wurde zu einer Belastung, als einige Doktoranden während ihrer Praktika in DDR-Fabriken beim Versuch erwischt worden sind, Betriebsgeheimnisse zu stehlen.
Der Personenkult um Kim Il Sung
Die DDR-Führung hatte größte Sorge um den „Personenkult“, der um den „großen Führer“ Kim Il Sung aufgebaut wurde. „Um Kim Il Sung konzentriert sich seit langem ein immer stärker werdender Personenkult. Alle Errungenschaften der Partei und des koreanischen Volkes werden in erster Linie dem Wirken des Genossen Kim Il Sung zugeschrieben. So wird eine Legende um Kim Il Sung geschaffen, die, bei allem Respekt vor den Aktivitäten des Genossen Kim Il Sung, nicht den wahren Tatsachen entspricht“, heißt es in einem internen SED-Parteibericht von 1961.
Wenn man diese allzu bekannte Seligsprechung eines starken Führers mit der starken Betonung des Koreanischseins und des koreanischen Volkes in der nordkoreanischen Propaganda verbindet, müssen DDR-Beamte, die sich noch an das Deutschland Adolf Hitlers erinnern, Parallelen bemerkt haben. Im selben SED-Bericht von 1961 heißt es weiter: „Die gesamte Propaganda der Nordkoreanischen Arbeiterpartei basiert nicht auf den Werken des Marxismus-Leninismus, sondern einzig und allein auf den ‚weisen Lehren unseres berühmten Führers, Genossen Kim Il Sung‘.“
Undankbarkeit, Lügen und Hungersnöte
Die DDR war nach der Sowjetunion und China der drittgrößte Geber von Finanzhilfe für Nordkorea. Aber die DDR hatte nicht immer das Gefühl, dass ihre Hilfe mit Wohlwollen angenommen wurde.
Der Hafen in Hamhung, der für Hunderte von Millionen wieder aufgebaut wurde, ist ein gutes Beispiel dafür. Er gab der DDR später nicht nur einen Vorgeschmack auf die Undankbarkeit, sondern auch einen Einblick in die Bereitschaft der Nordkoreaner, die eigene Bevölkerung zu täuschen und sogar der eigenen jüngsten Propaganda direkt zu widersprechen.
Als das Projekt 1962 aufgrund finanzieller Probleme in Ostberlin zwei Jahre früher als geplant endete, berichteten die nordkoreanischen Medien ausführlich über die Bemühungen. Kim Il Sung lobte die Unterstützung der DDR als „einen erhabenen Ausdruck proletarischen Internationalismus“. Doch innerhalb weniger Monate wurde die Rolle der DDR in dem Projekt heruntergespielt. Deutsche Firmenschilder wurden von den Maschinen in Hamhung entfernt und durch solche ersetzt, die nordkoreanische Produktion suggerierten. Dennoch stellte das DDR-Außenministerium 1964 fest, dass die Nordkoreaner Probleme mit den Maschinen oder Engpässe in den Fabriken weiterhin auf Versäumnisse der DDR zurückgeführt haben. Das entsprach nicht der Wahrheit. Die Nordkoreaner waren selbst nicht in der Lage, kleinste Reparaturarbeiten durchzuführen.
Die DDR brach zusammen, bevor in den 1990er-Jahren unter Kim Jong Il, dem Vater des heutigen Machthabers Kim Jong Un, die schlimmsten Hungersnöte Nordkoreas ausbrachen. Verlässliche Zahlen liegen nicht vor, doch wird angenommen, dass Nahrungsmittelknappheit zwischen 250.000 und 3,5 Millionen Menschenleben forderte. Selbst dieses Problem hatten DDR-Beamte in ihren Mitteilungen hervorgehoben. Ende der 1960er-Jahre, mehr als ein Jahrzehnt nach dem Koreakrieg, war die Lebensmittelrationierung noch in vollem Gange. Botschaftsmitarbeiter bemerkten aber die Skepsis der Öffentlichkeit gegenüber einem Parteitag der Koreanischen Arbeiterpartei im Jahr 1968, auf dem die Bereitstellung von mehr Lebensmitteln versprochen wurde.
„Die Forderung des Plenums nach ‚zehn Gramm Fett pro Tag und Kopf‘ wird von der Bevölkerung nicht ernst genommen, weil sie unrealistisch und viel zu hoch ist“, berichtete die langjährige Professorin für Koreanistik an der Ostberliner Humboldt-Universität Helga Picht damals. „Letztes Jahr lag der Durchschnitt – für das gesamte Jahr – bei nur 200 Gramm Fett pro Person.“ Eine wie so oft bewusst gewählte Täuschung der Partei und ein Widerspruch mit der grauen Realität zugleich – zumindest das haben die beiden sozialistischen „Bruderländer“ gemeinsam.

Dr. Tobias Lehmann hat an der University of Oregon zum Thema Wendeliteratur promoviert. Geboren 1981 in Eisenhüttenstadt war er lange Zeit in Südkorea und anschließend in den USA tätig.