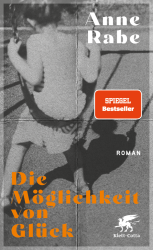Der Berliner Fernsehturm – mit 368 Metern das höchste Bauwerk Deutschlands – ziert unzählige Logos, Labels und Tourismusbroschüren. Mit über einer Million Besuchern jährlich ist er eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Deutschlands und er blickt auf eine bewegte Geschichte zurück.

Nahansicht der Turmkugel des Berliner Fernsehturms. Abbildung: studio kohlmeier berlin
Gebaut wurde der Fernsehturm von 1965 bis 1969 im internationalen Stil von der Deutschen Post der DDR, anstelle des abgerissenen Marienviertels in Berlin-Mitte. Ursprünglich sollte er an einem ganz anderen Ort errichtet werden: in Müggelberge, einem Hügelzug in Berlin-Köpenick. Dort hätte auch der Bau eines 130 Meter hohen Turms genügt, um die lückenlose Abdeckung des Fernsehempfangs zu gewährleisten. Doch nur ein Jahr nach Baubeginn im Jahr 1954 musste das Projekt mit dem Decknamen F4 eingestellt werden. Grund war die Feststellung des Innenministeriums, dass der Turm durch seine Höhe den Flugbetrieb am Rande der Einflugschneise des Flughafens Berlin-Schönefeld gefährden könnte. Das bis zum Zeitpunkt des Baustopps fertiggestellte Gebäude des Fernsehturms Müggelberge wurde später wetterfest gemacht und dient heute der Deutschen Telekom als Richtfunkknoten.

Ehemaliger Fernsehturm in Müggelberge. Abbildung: Wikimedia Commons, Wladyslaw Sojka
Schon früher galt: Lage, Lage, Lage!
In den folgenden Jahren hätte die DDR-Regierung das Monumentalbauwerk aus gut 11.000 Kubikmetern Stahl und Beton dann beinahe mitten in den Volkspark Friedrichshain gestellt, doch auch dieser Plan misslang. Diesmal scheiterte das Bauvorhaben an schlichtem Geldmangel, weil die Regierung (unter anderem wegen der horrenden Kosten des Baus der Berliner Mauer) in einer wirtschaftlichen Krise steckte. Den heutigen Standort hatte schließlich Gerhard Kosel, damaliger Präsident der Deutschen Bauakademie 1964, vorgeschlagen. Daraufhin wurde das Projekt von Walter Ulbricht, dem ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED, abgesegnet und in Auftrag gegeben.
Fundament eines Berliner Schwarzbaus
Mit dem Fund des idealen Standorts hörte die abenteuerliche Entstehungsgeschichte des Berliner Fernsehturms noch nicht auf. Schon nach wenigen Monaten waren die Kosten des Baus derart explodiert, dass die veranschlagten Gesamtkosten von 33 Millionen Mark bereits überschritten waren. Grund dafür waren die Abrissarbeiten teils völlig intakter Gebäude auf knapp 30.000 m2 Wohn- und Lagerfläche und damit einhergehende Entschädigungszahlungen, die mit insgesamt 38,8 Millionen Mark zu Buche schlugen. Aus diesem Grund erteilten Bauaufsicht und Plankommission keine weiteren Sondergenehmigungen mehr, was im Sommer 1965 zum völligen Baustopp führte. Erst ein Eingriff auf oberster Regierungsebene sorgte für die Fortsetzung der Arbeiten am Projekt. So gingen die Arbeiten weiter – ohne offizielle Grundsteinlegung, Baugenehmigung oder ersten Spatenstich.

Stumpf des Berliner Fernsehturms. Baufortschritt am 10. August 1966. Abbildung: Creative Commons, CC BY-SA 3.0, Roehrensee
Berliner Fernsehturm: Bau und Fertigstellung
Nachdem das Fundament im Herbst 1965 fertiggestellt worden war, konnte der Turmschaft mittels Kletterbauweise errichtet werden. Die weiteren Bauarbeiten gingen zügig voran, sodass der Turm bereits ein Jahr später, am 4. Oktober 1966, die 100-Meter-Marke knackte. Parallel dazu wurde die Turmkugel in Vormontage konstruiert, für die sogar Edelstahl aus Westdeutschland importiert wurde. Zwischenbilanz 1967: Baukosten von 95 Millionen Mark. Von März bis Oktober 1968 wurden die Segmente der Kugel in die Höhe gehoben und montiert. Nach der Fertigstellung dieses Bauabschnitts am 7. Oktober wurde die Flagge der DDR gehisst und das Richtfest gefeiert. Es folgten die Arbeiten an der Spitze und dem über der Kugel befindlichen Antennengerüst sowie der Innenausbau. Am 3. Oktober 1969 erfolgte die Eröffnung. Doch die 53 Monate Bauzeit im Dreischichtbetrieb hinterließen tiefe Spuren im Budget. Am Ende beliefen sich die Kosten auf über 132 Millionen DDR-Mark – einem Vielfachen des ursprünglich Geplanten.

Hissen der Flagge auf der fertiggestellten Turmkugel. Abbildung: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Sturm, Horst, CC-BY-SA 3.0
Aussichtsplattform und Sphere Bar
„Fernmeldeturm 32“ heißt er ganz offiziell, der Berliner Fernsehturm. Er dient seit jeher als Standort mehrerer Rundfunksender für Hörfunk und Fernsehen. Seine Hauptattraktion ist aber eine andere. Die meisten Besucher interessieren sich weit mehr für die Aussichtsplattform samt Bar auf 203 Metern sowie das Drehrestaurant auf 207 Metern Höhe. Schließlich hat man von beiden Locations aus einen einmaligen Rundumblick auf die Weiten der Hauptstadt. Das Standardticket für einen Besuch der Aussichtsplattform kostet regulär 30,50 Euro.
Nach umfassenden Umbaumaßnahmen wurde die auf der unteren Aussichtsplattform befindliche höchste Bar Berlins als „Sphere Bar“ Anfang 2024 neu eröffnet. Entworfen und umgesetzt wurde das Konzept vom Stuttgarter Büro DIA Dittel Architekten. Dieses hat darauf geachtet, beim Interior das Flair des Originaldesigns zu erhalten, ohne dabei altbacken zu wirken. Beim neuen Barkonzept setzt man auf regionale Produkte und Partner. So finden sich Brlo-Biere an der Zapfanlage, Mampe-Spirituosen in den Longdrinks und bei den Snacks Brotkreationen von Zeit für Brot. Die ostdeutschland.info-Redaktion hat sich bei einem Besuch des Fernsehturms Ende September von der Qualität der angebotenen Speisen überzeugt. Passend zur Location sind die Preise gehoben, aber angemessen. An der Sphere Bar kostet die Currywurst 9,50 Euro, genau wie der halbe Liter Bier.

Die neue Sphere Bar auf der Aussichtsplattform. Abbildung: Sphere Bar im Berliner Fernsehturm
Zu Gast im höchstgelegenen Kugelrestaurant der Welt
Ein Stockwerk höher wurde das ehemalige „Telecafé“ komplett renoviert und als „Sphere by Tim Raue“ Anfang Juni 2025 neu eröffnet. „Der Fernsehturm ist das Wahrzeichen Berlins – für mich als Berliner ist es eine Herzensangelegenheit, diesen Ort kulinarisch zu gestalten und damit Ost und West auf dem Teller zu vereinen“, so Sternekoch Raue in diesem Zusammenhang. Dem holprigen Start mit ausgefallenem Kassensystem und von Gästen als zu klein empfundenen Portionen zum Trotz besteht weiterhin hoher Andrang auf die 240 Plätze des beliebten Drehrestaurants. Da stört es auch nicht, dass Gäste die 90-Minuten-Reservierung bezahlen müssen (regulär 33,50 Euro). Auf der Karte warten dann zum Beispiel der Garnelen-Cocktail KaDeWe (16 Euro), Königsberger Klopse (28 Euro) und eine Schweden-Eisbecher (7,50 Euro).
Auch im Restaurant waren die DIA Dittel Architekten am Werk. Sie haben viel Wert gelegt auf warme Farben, ikonische Linien und einen Hauch Pan-Am-Lounge-Flair. „Wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis des Umbaus“, schwärmt Anja Nitsch, die Geschäftsführerin des Berliner Fernsehturms. „Es ist ein Restaurant entstanden, in dem man sich wohl und willkommen fühlt und wo man, dank des gut durchdachten Lichtkonzepts auch in den Abendstunden einen unvergleichlichen Blick über unsere Stadt hat.“

Tim Raue präsentiert das „Sphere“ im Drehrestaurant des Berliner Fernsehturms. Abbildung: Nils Hasenau
Geschichte zum Anfassen
Ein Highlight für Geschichtsfans sind die Ausstellungsflächen im Foyer des Fernsehturms. Denn dort lassen sich seine Entstehung und die geheimen Orte in seinem Inneren virtuell erkunden. Dabei legt das VR-Erlebnis „Berlin’s Odyssey“ den Fokus auf die Geschichte Berlins, während Teil zwei „Berlin’s Odyssey ‒ The Berliner Fernsehturm Discovery“ die Entstehung des Turms erlebbar macht. Im oberen Foyer des Berliner Fernsehturms befindet sich zudem eine historische Dauerausstellung mit fünf interaktiven Inseln, welche die Geschichte der Stadt und des Turms mit bewegten Bildern, Videos und einem interaktiven Stadtmodell erzählen. Tickets beinhalten den Eintritt zur Aussichtsplattform und kosten regulär 36,50 Euro.

Der Berliner Fernsehturm lässt sich vor Ort auch virtuell erkunden. Abbildung: Silver Nebula
Von Telespargel bis Sankt Walter
Übrigens heißt es oft, die Berliner würden den Fernsehturm „Telespargel“ nennen. Aber dieser Spitzname war von den DDR-Offiziellen gewünscht und setzte sich schon vor 1989 nicht durch. Dagegen kursierten vom Volk geschaffene Spitznamen wie „Imponierkeule“, „Protzstengel“ und aufgrund des bei direkter Sonneneinstrahlung auf der Turmkugel entstehenden Lichtkreuzes „Rache des Papstes“ oder „Sankt Walter“. Gänzlich falsch ist im Übrigen die Bezeichnung Alex – damit ist der Alexanderplatz neben dem Fernsehturm gemeint. Die Berliner sagen in der Regel einfach Fernsehturm. Und die meisten von ihnen würden sich sicher freuen, wenn man ihn weiterhin von überall in der Stadt aus sehen könnte statt ihn zuzubauen.