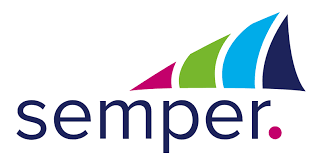Am 3. Oktober 2025 feierte Deutschland 35 Jahre deutsche Einheit. Die Teilung verlief nicht nur in Berlin mitten durch Orte hindurch. Die ehemalige Volkskammerpräsidentin und Bundesministerin Frau Dr. Sabine Bergmann-Pohl beschreibt den Weg von der Teilung zur Vereinigung.

Dr. Sabine Bergmann-Pohl beschreibt den Weg von der Teilung zur Vereinigung. Abbildung: Deutsche Gesellschaft e. V.
Kürzlich folgte ich einer Einladung nach Mödlareuth, jenem historischen Ort an der einstigen innerdeutschen Grenze, dem auch das Berliner Schicksal der Teilung widerfuhr. Hier wurde eine neue Ausstellung eingeweiht. Grund genug, die jüngste deutsche Geschichte Revue passieren zu lassen. Auch wenn der Weg vom „Big Berlin“ ins „Little Berlin“ nicht ganz einfach war, bin ich der Einladung gern gefolgt. Nicht zuletzt weil die geografischen Bedingungen einmal mehr Erinnerungen freisetzten. Und das waren vor allem biografische Eckdaten, die mich sowohl mit Thüringen als auch Berlin verbinden. Denn geboren bin ich in Eisenach, auch eine thüringische Grenzstadt, wenngleich jenseits der Grenze das Bundesland Hessen liegt und nicht Bayern. Aber von Bayern und Hessen sprach man in Eisenach und der DDR ohnehin nicht. Sondern das war der Westen, wie alles hinter Mauer und Stacheldraht Westen war, egal ob im Norden oder im Süden. Thüringen ist für mich immer noch Heimat, obwohl meine Familie 1957 nach Ostberlin zog.
Nun ist die Geschichte von Mödlareuth eine ganz besondere. Spektakulär allemal, auch wenn zu befürchten ist, dass viele unserer Landsleute auf eine Nachfrage mit dem Namen noch immer wenig anfangen können. Mit Schrecken denke ich daran, was deutsche Schüler über die letzte deutsche Diktatur wissen. So erinnere ich mich, fast peinlich berührt, an eine Schulumfrage, nach der 40 Prozent der Schüler keinen Unterschied zwischen einer Diktatur und einer Demokratie sahen. Ebenso konnten 40 Prozent nichts mit Erich Honecker anfangen. Immerhin haben ihn sieben Prozent der deutschen Gymnasiasten (nicht der Hauptschüler!) zum Staatsoberhaupt gemacht – allerdings nicht der DDR, sondern zum zweiten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Die Liste von Peinlichkeiten ließe sich fortsetzen, umso wichtiger ist es, sich gemeinsam in Ost und West der Geschichte zu stellen.

Am 9. Dezember 1989 feierte Mödlareuth seinen Mauerfall. Abbildung: PantheraLeo1359531
Verlust von Häusern und Höfen
In Mödlareuth geschieht dies vorbildhaft. Denn Zukunft gibt es nur da, wo die Vergangenheit aufgearbeitet und nicht verklärt wird. Doch nicht nur Museen allein sind hier in der Pflicht, es sind die Universitäten, die Schulen, die Vereine und Verbände. Und die Medien! Gern erinnere ich in diesem Zusammenhang an einen Fernsehfilm mit dem Titel „Tannbach – Schicksal eines Dorfes“. Er zeigte in starken Bildern die Trennung des Ortes durch den Tannbach und wie aus einer ländlichen Idylle eine unüberwindbare Staatsgrenze geworden ist. Hier haben Deutsche auf Deutsche geschossen. So wie in dem großen Berlin, an dessen menschenverachtender Mauer allein 140 Menschen starben. Aber sie starben auch im Harz, bei Fluchtversuchen in der Altmark oder auf der Ostsee. 330 Menschen waren es an der innerdeutschen Grenze, mindestens 200 im sogenannten sozialistischen Ausland. Bis heute gibt es noch eine Dunkelziffer! Doch müssen wir uns nicht nur der erschossenen oder ertrunkenen Landsleute erinnern, sondern auch an all jene denken, denen die Diktatur an Leib und Seele Schaden zugefügt hat. Hunderttausende waren inhaftiert, Millionen sind um berufliche Aufstiegschancen gebracht, zu Duckmäusern erzogen worden. Wer nicht mitmachte, wurde drangsaliert, verfolgt, gedemütigt. Selbst die einfachsten Bürgerrechte – Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, Versammlungsfreiheit – wurden den Deutschen in der DDR vorenthalten. Besonders perfide waren die Aktionen der Stasi. Zwangsaussiedlungen an der innerdeutschen Grenze sind hierfür ein Stichwort. Sie liefen unter dem Codewort „Ungeziefer“. So verloren auch in Mödlareuth Menschen ihre Häuser und Höfe. Im Jargon der Stasi waren sie „Ungeziefer“. Ungeziefer, weil sie einem menschenverachtenden Grenzregime im Weg standen oder wohnten. Egal ob in Mödlareuth, im Eichsfeld, an der Elbe oder an der Mauer zwischen Ost- und Westberlin.

Die Ausstellung zu 35 Jahren Mauerfall im Jahr 2024. Abbildung: CC BY-4.0/ PantheraLeo1359531.
Ich verbrachte vor 1957, als wir noch in Thüringen lebten, den Sommer und später bis zum Bau der Mauer am 13. August 1961 die Wochenenden bei meinen Großeltern in Westberlin, in Kladow am Glienicker See. Eine Kindheit, die die Mauer und eine Grenze zwischen Ost und West noch überwinden konnte. Nach dem Umzug nach Ostberlin wohnten wir in Hohenschönhausen. Dort besuchte ich auch die Schule. Was keiner von uns wusste: Gleich um die Ecke befand sich das berüchtigte Stasigefängnis. Es lag in einem Sperrgebiet. Allein hier wurden mitten in einem Wohngebiet 11.000 Menschen inhaftiert. Unter ihnen auch SED-Kritiker, die aus dem Westen entführt wurden. Doch auch die heile Kinderwelt fand bald ihr Ende. Im Rahmen „der sozialistischen Erziehung“ nahm der ideologische Druck stetig zu. Wir Konfirmanden wurden in der achten Klasse auch zur Jugendweihe gezwungen, mit der Drohung, sonst nicht zum Abitur zugelassen zu werden. Meine Konfirmation im Mai 1961 war das letzte große Familienfest in meiner Familie zwischen Ost und West.
Entstehen einer Nischengesellschaft
Der Mauerbau machte das Leben nicht einfacher. Und das nicht nur wegen der Mangelwirtschaft. Die staatliche Bevormundung zwang viele Menschen zu äußerer Anpassung, aber auch zu innerem Widerstand. Es entstand eine Nischengesellschaft, die im Arbeits- und öffentlichen Leben eine andere Sprache erforderte als im Freundes- und Familienkreis. Schon Kinder lernten frühzeitig, mit gespaltener Zunge zu reden. In der Öffentlichkeit hielt man sich mit der persönlichen Meinung zurück, während man in der Privatsphäre genau dazu neigte. Dass dies nicht ungefährlich war, belegen die Staatssicherheitsakten. Manch allzu freie Meinungsäußerung endete mit dem Gefängnis oder dem Verlust der beruflichen Laufbahn. Mir selbst wurde zunächst das Medizinstudium verwehrt. Begründung: Ich sei kein Arbeiter- und Bauernkind, denn mein Vater war Arzt. Während eines zweijährigen Praktikums in der Gerichtsmedizin der Humboldt-Universität nahm mich der damalige Chef, Prof. Dr. Otto Prokop, ein weit über die Grenzen Deutschlands bekannter Gerichtsmediziner, unter seine persönliche Obhut. Ihm habe ich wohl die Zulassung zum Medizinstudium an der Humboldt-Universität zu verdanken. Anderen war dieser Weg nicht vergönnt. Am wenigsten denen, die mutig dem Regime die Stirn boten. Sie waren es, die die Gefängnisse füllten oder des Landes verwiesen wurden. Je nachdem, wie prominent sie waren.

Die Zonengrenze am Tannbach in Mödlareuth im Juli 1949. Abbildung: Bundesarchiv, Bild 183-N0415-363/Otto Donath/CC-BY-SA 3.0.
Einer der prominentesten war sicherlich Wolf Biermann, ein Liedermacher, dessen Zwangsausbürgerung 1976, also vor 50 Jahren, eine Welle der Solidarität unter Künstlern und Kritikern auslöste und die DDR bis ins Mark erschütterte. An seiner Ausbürgerung begannen selbst SED-Genossen zu zweifeln. Weniger spektakulär war das Wirken vieler oppositioneller Gruppen, meist unter dem Dach der Kirche. Aber auch eine Welle von Antragstellungen zur Ausreise aus der DDR machte der Diktatur zu schaffen. Hunderttausende, die nicht mehr willens waren, in der DDR zu bleiben. Sie wollten für sich und ihre Kinder eine bessere Zukunft. Ohne Bevormundung, als freie Bürger in einem freien Land. Und ja, sie schauten sehnsüchtig auf den anderen Teil eines Landes, der auch deutsch war wie der ihre, aber in dem diese Freiheit zu Hause war. Sie, die Bürger der DDR, die um ein Vielfaches besser über den Westen informiert waren, als der Westen über den Osten, sahen, wie eine freiheitlich-demokratische Rechtsordnung, der Rechtsstaat und ein funktionierendes Wirtschaftssystem Aufschwung und Wohlstand sicherten. Die DDR-Bürger wussten, dass sie dem bundesrepublikanischen Wirtschaftssystem uneinholbar hinterherhinkten. Da halfen der SED-Führung weder das Märchen von der zehntgrößten Volkswirtschaft der Welt noch die Parole vom „Überholen ohne einzuholen“!
Doch es gab nicht nur den Willen, teilzuhaben am freiheitlichen demokratischen System und westlichen Wohlstand. Es gab etwas, was heute viel zu schnell vergessen wird: das Gefühl der Zusammengehörigkeit als Nation. Dieses positive Nationalbewusstsein hat die Bürger in der DDR beseelt. Für sie waren München, Köln und Hamburg eben nicht Orte im Ausland, während für manch einen Westdeutschen Dresden und Erfurt im Bewusstsein weiter entfernt waren als Paris und Rom. Trotz Wiedervereinigungsgebot im Grundgesetz war die DDR für manch einen Westdeutschen eben Ausland. Zur Wahrheit gehört auch heute, dass es politisch Verantwortliche und sogar Parteien gab, die die Staatsbürgerschaft der DDR anerkennen, die das Strafregister Salzgitter (zu Grenztoten und Opfern politischer Justiz in der DDR; Anm. d. Red.) auflösen und das Wiedervereinigungsgebot streichen wollten. Zum Glück hat sich die Vernunft durchgesetzt.
Schon das Gemisch aus nationalem Selbstbewusstsein und dem Willen, politische Veränderungen zu erzwingen oder ggf. durch Ausreise dem Staat den Rücken zu kehren war für die DDR explosiv genug. Dabei stand sie schon mit ihrer desolaten, auf Verschleiß fahrenden Wirtschaft auf wackligen Füßen. Doch es kam noch schlimmer für die DDR-Oberen. Und diese Botschaft kam ausgerechnet aus Moskau. Sie trug einen Namen: Michail Gorbatschow. Es ist schon eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet der Generalsekretär der größten kommunistischen Partei der Welt den Weg für das Ende der DDR und sogar die deutsche Wiedervereinigung ebnete.
Erinnern wir uns an die ersten Demonstrationen seit dem Sommer 1989, die noch durch Polizeigewalt aufgelöst werden konnten. Denken wir an die Botschaftsbesetzungen in Prag, Budapest und Warschau sowie den internationalen Druck, der den greisen und wie Honecker teilweise schwer kranken alten Männern im Politbüro und Zentralkomitee erwuchs. Reformen nach dem Muster von Glasnost und Perestroika konnte die DDR überhaupt nicht gebrauchen. Es war nur schwierig, eine Absage zu formulieren, hieß es doch bis dato, und damit ist jeder DDR-Bürger groß geworden: „Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen.“ Was also sollte man nun lernen? Der politisch überforderte Honecker erkannte überhaupt nicht den Ernst der Lage. Ganz im Gegenteil, noch im Januar 1989 prophezeite er, dass die Mauer noch 100 Jahre stehen würde. Damit brachte er nur die Bevölkerung gegen sich auf.
Heiße Phase 1989
Mit dem 6. und 7. Oktober 1989 war die friedliche Revolution in die heiße Phase getreten. Überall im Land, vor allem aber in Plauen, Dresden und Berlin, kam es ausgerechnet am DDR-Feiertag zu Demonstrationen. Mit Kerzen in den Händen und den Rufen: „Keine Gewalt!“ stellten sich die Menschen mutig dem SED-Machtmonopol entgegen. Doch Militär, Polizei und Staatssicherheit wurden angesichts der Kerzen und der Friedfertigkeit der Demonstranten zum stumpfen Schwert. Und es blieb stumpf angesichts der schieren Masse von 70.000 Menschen, die am 9. Oktober in Leipzig friedlich demonstrierten.
In der Folge wuchs im Politbüro die Einsicht in die dramatische wie aussichtslose Lage. Mit einem Putsch von innen wird Honecker von seinen eigenen Genossen am 18. Oktober abgesetzt. „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“. Dieser irrtümlich Gorbatschow nachgesagte Satz sollte nun für den SED-Chef stehen. Auf dem Berliner Alexanderplatz demonstrierte bereits am 4. November über eine halbe Million Menschen. Ohne Honecker und mit Krenz an der Spitze versuchte das Politbüro einen neuen Befreiungsschlag. Ein Reisegesetz musste her. Damit hoffte man, die aufgebrachten Volksmassen zu beruhigen und ihr Interesse nach dem Westen auszurichten. Doch selbst die Verkündung des neuen, sehnsüchtig erwarteten Reisegesetzes ging schief. Auf der legendären Pressekonferenz am 9. November stotterte Günter Schabowski in Unwissenheit des Inhalts den Textentwurf herunter und löste eine nächtliche Massenbewegung aus. Die Bilder des Tages kennen wir. Der 9. November 1989 wurde vielleicht zum glücklichsten Tag in der deutschen Geschichte.

Die Mödlareuther Mauer trennte Bayern von Thüringen. Abbildung: CC BY-4.0/ PantheraLeo1359531.
Gern erinnern wir uns an die Euphorie des Tages, das grenzenlose Staunen und die glücklichen Gesichter. Diese gab es auch in Mödlareuth, allerdings tickten die Uhren im „Little Berlin“ etwas langsamer. Erst im Dezember kamen die Menschen in beiden Teilen mit Kerzen und Fackeln sowie dem Ruf „Die Mauer muss weg“ dank eines fünf Meter breiten Weges zusammen. Allerdings mit Passkontrolle und nächtlicher Schließung. Doch die Welt schaute weiter auf die große Schwester.
Während es auf der Demonstration am 4. November auf dem Berliner Alexanderplatz noch keine einzige Losung gab, die die Wiedervereinigung forderte, änderte sich dies mit dem Mauerfall umgehend. Bis dato kann man von einer „demokratischen Phase“ der Revolution sprechen. Es ging um bürgerliche Freiheiten, symbolisiert in dem Spruch „Wir sind das Volk“. Doch mit diesem Spruch wurde die „nationale Phase“ der Revolution eingeläutet. Die Forderung nach Wiedervereinigung, zunächst zaghaft vorgetragen, gewann mit Helmut Kohls Zehn-Punkte-Programm und entsprechenden Verlautbarungen einiger Oppositionsgruppen an Fahrt.
Begleitet wurde der Chor von „Deutschland einig Vaterland“ durch ein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer in Städten und Dörfern. In diesem Fahnenmeer ertrank geradezu die DDR und die alte Ordnung. Ich weiß noch heute, wie befremdlich manch westdeutscher Besucher geschaut hat, wenn er 1989/90 durch ostdeutsche Orte fuhr, in denen schwarz-rot-goldene Fahnen zu Hunderten wehten.
Erste freie Wahlen
Willy Brandt begrüßte den Mauerfall ganz patriotisch mit den Worten: „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört.“ Dass dieses Zusammenwachsen nach vierzigjähriger Trennung in zwei völlig verschiedenen politischen und ökonomischen Systemen schwierig sein würde, blendeten viele Zeitgenossen aus. Zu groß war die Euphorie über die Wiedervereinigung. Die Ostdeutschen taumelten geradezu freudetrunken in ein neues Land. Doch genauso schnell holte sie die Wirklichkeit ein. Die Realität hatte vor allem mit maroden Betrieben und einer katastrophalen Wirtschaftssituation zu tun. Aber auch mit mentalen Unterschieden, die nach Jahrzehnten unterschiedlicher Sozialisation und tiefen Wunden, die uns die Geschichte hinterließ, nicht ausbleiben konnten. Dazu reicht schon ein Blick auf die ehemals innerdeutsche Grenze, die uns jetzt als grünes Band versöhnt.
Nur vier Monate nach dem Fall der Mauer konnten die Bürger in der DDR das erste Mal frei wählen. Vorausgegangen war ein sogenannter „Runder Tisch“, der eigentlich viereckig war und an dem Regierung und Opposition gleichermaßen Platz fanden. Er hatte die Wahlen vorbereitet. Die Ergebnisse der Volkskammerwahl waren weder manipuliert, wie sonst üblich, noch trafen die Vorhersagen der Wahlforscher ein.
Die Wahlen zur Volkskammer am 18. März 1990 waren ein wichtiger Bestandteil des Demokratisierungsprozesses, der sich im ganzen Lande vollzog. Das spiegelte sich auch in der Wahlbeteiligung von 92 Prozent wider, einem heute traumhaften Wert. Die Demokratie, die in der alten Bundesrepublik bereits Jahrzehnte früher mithilfe der westlichen Besatzungsmächte Wirklichkeit geworden war, hatte nun in ganz Deutschland gesiegt. Aus eigener Kraft wurde so die Voraussetzung zur Herstellung der deutschen Einheit geschaffen. Vor allem aber war es eine nicht zu unterschätzende „Mitgift“ in die gemeinsame Zukunft.
Ein grünes Band als Symbol
Es ist müßig, jetzt 35 Jahre später über die Fehler der Wiedervereinigung zu lamentieren oder uns vorzurechnen, was uns trennt. Ich hatte bereits bei der letzten Volkskammersitzung Folgendes ausgeführt: „Viel Geduld und Einfühlungsvermögen auf beiden Seiten werden notwendig sein, damit keine Seite Schaden nimmt, damit alte Gräben zugeschüttet werden und neue nicht entstehen können.“ Manchmal vermisse ich bis heute diese Geduld und das Einfühlungsvermögen. Und eine gewisse Ehrlichkeit. Denn wer mit offenen Augen durch die neuen Länder geht, wird sie zweifelsfrei erkennen. Es sind jene blühenden Landschaften, die Helmut Kohl einst beschwor. Die Deutschen insgesamt können auf das Erreichte stolz sein. Auch jene, die durch ein tiefes Tal der Tränen gingen.
Dennoch: Es bleibt viel zu tun, der Reformstau ist kein ostdeutscher, sondern ein gesamtdeutscher. Und die Herausforderungen der Zukunft, gerade in einer unsicher werdenden Welt, betreffen uns alle. Der ehemalige Todesstreifen ist heute ein 1.400 km langer Biotopverbund quer durch Deutschland, angeregt 1989 durch den BUND e.V. Bayern. Er ist als grünes Band ein Symbol für die friedliche Überwindung der Teilung Deutschlands und auch für das Miteinander von Menschen und Generationen.
Das ist die Herausforderung für die Zukunft. Aber Zukunft haben wir nur dort, wo wir mit einem klaren Blick in die Vergangenheit schauen. In diesem Sinne ist die Ausstellung im Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth Zeugnis und Mahnung zugleich und für unser eigenes Selbstverständnis längst überfällig.