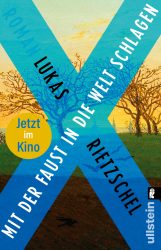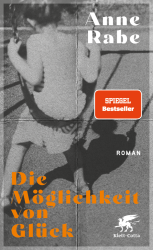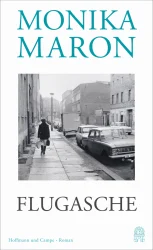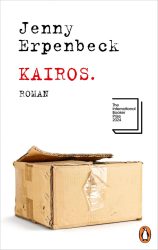Der Osten Deutschlands ist auch in den Medien nicht ausreichend repräsentiert. Er verfügt über keine eigene Öffentlichkeit. Dennoch hat sich ein Ostbewusstsein herausgebildet. Der Literaturwissenschaftler Dr. Tobias Lehmann, dessen Literaturkolumne hier beginnt, zeichnet diese Entwicklung nach.

Dr. Tobias Lehmann wurde zum Thema Wendeliteratur promoviert. Geboren 1981 in Eisenhüttenstadt war er lange Zeit in Südkorea und anschließend in den USA tätig.
Die Medien haben dazu beigetragen, dass die Vergangenheit in Ostdeutschland nicht so aufgearbeitet wurde, wie es sich die Menschen gewünscht hätten. Politische Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit können nur dort intensiviert werden, wo Medienunternehmen, Redaktionen und Journalismus eine Öffentlichkeit schaffen, in der Debatten kontinuierlich und thematisch fokussiert geführt werden können. Für Ostdeutschland war diese Bedingung nicht erfüllt, denn der Beitritt zur Bundesrepublik bedeutete auch den Anschluss an die Infrastruktur der westdeutschen Öffentlichkeit mit ihren eigenen Themen, Diskursen und Reibungen und vor allem mit westdeutschem Personal.
Die Ostdeutschen kamen, so Jürgen Habermas, nicht in den Genuss einer eigenen Öffentlichkeit. Die deutschen Medien wurden und werden von Westdeutschen gemacht. Die Standorte sind fast alle in Westdeutschland, und nur wenige Ostdeutsche konsumieren diese Medien. Die großen überregionalen Tages- und Wochenzeitungen mit Sitz in Frankfurt/Main, München oder Hamburg werden in Ostdeutschland kaum verkauft und gelesen. In mittelgroßen Städten in meinem Heimatland Brandenburg oder in Thüringen, wo ich studiert habe, ist es sogar schwierig, sie überhaupt am Kiosk zu bekommen.
Süddeutsche, F.A.Z. und Spiegel verkaufen im Osten nur zwischen 2,5 und vier Prozent ihrer Gesamtauflage, sodass man mit Fug und Recht von einem „Mediengefälle“ ausgehen kann, wie es Steffen Mau in seiner jüngsten Publikation „Ungleich vereint“ darlegt. Viele Debatten, die im Politikteil oder im Feuilleton geführt werden, erreichen Ostdeutschland gar nicht. Soweit ein spezifisch ostdeutscher Diskurs in den Medien stattfindet, beschränkt er sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auf eine Vergewisserung ostdeutscher (politischer und soziokultureller) DDR-Traditionen, wie sie in ostdeutschen Medien wie Super Illu, Junge Welt und Neues Deutschland zu lesen sind. Man könnte auch behaupten, dass die Ostdeutschen „ihrer“ Medien „enteignet“ wurden, wenn es in der DDR eine freie Öffentlichkeit gegeben hätte.
Habermas bringt es auf den Punkt: Weder vor 1989 noch danach verfügte die ostdeutsche Bevölkerung über eine eigene politische Öffentlichkeit, in der widerstreitende und konkurrierende Gruppen eine Debatte über das Selbstverständnis hätten führen können. Weil 1945 auf eine Diktatur eine andere folgte (wenn auch eine ganz andere Art von Diktatur), konnte eine spontane, selbstgesteuerte, mühsam selbstkritische Klärung eines verschütteten politischen Bewusstseins in den folgenden Jahrzehnten nicht in der gleichen Weise stattfinden wie in der Bundesrepublik.
Die Medienlandschaft zeigt deutlich, dass es immer noch eine Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland gibt. Die soziokulturellen Linien, entlang derer diese Kluft verläuft, zeigen sich im unterschiedlich geprägten Habitus, in der Sprache, im Essen, in der Literatur und vor allem in den unterschiedlichen Medienpräferenzen. Die Mehrheit der Ostdeutschen trauert zwar nicht dem Verlust der Leitmedien der DDR nach, obwohl Neues Deutschland und Junge Welt als linksorientierte Presse immer noch kursieren, aber viele Ostdeutsche informieren sich anders als Westdeutsche, weil sie sich anderen – mental anders gelagerten – Medientraditionen zuwenden. Diese sind vor allem billig und oft boulevardesk. Sie beschäftigen sich mit „ihren“ typisch ostdeutschen Themen, mit denen sie sich auskennen und zu denen sie leichten Zugang haben.
Das gilt auch für das Essen. Während es in Westdeutschland kulinarische Spezialitäten nach Regionen und Bundesländern gibt, wird der Osten als Ganzes pauschalisiert und man spricht oft von ostdeutscher statt von thüringischer oder sächsischer Küche. Auch in der Ausdrucksweise, vor allem in der Lexik, gibt es Unterschiede. Ostdeutsche Bezeichnungen wie Kaufhalle (Supermarkt), Anorak (Jacke), Broiler (halber Hahn), Nicki (T-Shirt), Selters (Mineralwasser) oder Polylux (Overheadprojektor) werden im Westen wohl kaum zu verstehen sein. Nicht zuletzt wird es wohl nur wenige Westdeutsche geben, die Literatur ostdeutscher Autorinnen oder Autoren lesen, obwohl alle Ostdeutschen in der Schule westdeutsche Literatur lesen müssen. Und wie viele Westdeutsche kennen ostdeutsche Musik? Man könnte viele Bereiche des kulturellen Lebens untersuchen, um festzustellen, ob und inwieweit die Unterschiede essenzialisiert und somit unveränderbar sind oder gar eine fest verankerte Trennung entlang dieser Linien besteht. Eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten sind Ost- und Westdeutsche jedenfalls noch nicht, auch wenn die jüngere Generation, wie Jana Hensel in „Zonenkinder“ feststellte, nach dem ersten westdeutschen Kulturschock zunehmend zu Grenzgängern mutiert und sich viele voneinander angenommene Wesenheiten vermischen.
Man könnte also, wie Valerie Schönian es tut, meinen, dass sich ein „Ostbewusstsein“ infolge der Wende entwickelt hat. Es macht jedoch wenig Sinn, Ostdeutsche zu kategorisieren und diesen Begriff im Singular zu verwenden, als ob es sich um einen Migrationshintergrund handeln würde, wenngleich diese These inzwischen auch diskutiert wird. Ostdeutsche und Migranten erfahren gleichermaßen Stigmatisierung, sagt Naika Foroutan. Viele Erfahrungen, die Ostdeutsche machen, ähneln denen von Migranten hierzulande. Dazu gehören der Verlust der Heimat, vergangene Sehnsuchtsorte, Gefühle der Fremdheit und Erfahrungen der Abwertung. Migranten haben ihre Länder verlassen, Ostdeutsche sind von ihrem Land im Stich gelassen worden. Ostdeutsche haben es aber ebenso wenig verdient, essenzialisiert oder gar darauf reduziert zu werden wie Migranten. Für mich kann es Begriffe wie „Ostbewusstsein“ nur im Plural geben, auch wenn immer wieder versucht wird, sie zu vereinfachen und politisch zu nutzen. Wenn jemand wie Jana Hensel behauptet „Wir Ostdeutschen“, sollte man genau hinhören, welche kollektive Kategorie damit aufgerufen wird und welche nicht.
Es ist auch bezeichnend, dass es im Bereich der Identitäten kein Pendant zum Ostdeutschsein gibt – kein westdeutsches Äquivalent. Ein starkes Identitätsgefühl als Westdeutscher lässt sich nicht herstellen. Die große Mehrheit der Westdeutschen kann mit diesem Label wenig anfangen und pflegt lieber regionale oder landesspezifische Selbstbilder. Die „Ossi/Wessi“-Unterscheidung, die in Ostdeutschland eigentlich eine wichtige Richtschnur ist, hat im Westen keine Entsprechung. Man könnte also Dirk Oschmanns Aussagen umkehren und behaupten: Der Osten hat den Westen erfunden – als Antwort auf die gesellschaftliche Dominanz. Und vielleicht erfindet er sich sogar selbst – als Antwort auf einen imaginierten und monolithischen Westen und ein wahrgenommenes oder angenommenes Bild von Ostdeutschland, das die Westdeutschen haben.