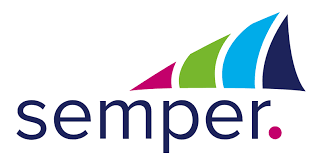In der hier beginnenden Kolumne thematisiert der ostdeutsche Unternehmer Daniel Heidrich Aspekte wie Eigentum, Wirtschaft, Demokratie, Gerechtigkeit und Freiheit im Osten. Eine Kolumne über den Osten, dessen Zukunft und vieles, was dem Westen noch bevorsteht. Daniel Heidrich startet mit einem Prolog.

Daniel Heidrich wurde 1975 in Berlin-Köpenick geboren. Er ist ein erfolgreicher und meinungsstarker ostdeutscher Unternehmer. ebk-gruppe.com
„[Paul Bäumer] fiel im Oktober 1918, an einem Tage, der so ruhig und still war an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte, im Westen sei nichts Neues zu melden.“ Aus Erich Maria Remarque: „Im Westen nichts Neues“, 1928.
Die Geschichte Europas, die Geschichte der Welt, so scheint es, wird immer im Westen entschieden. Der D-Day und die Landung der Amerikaner beenden den Zweiten Weltkrieg. Der Marshallplan ordnet die Stärke Europas neu. Der Fall des Eisernen Vorhangs wird den Deutschen zugeschrieben und nicht den Ungarn oder den Polen. Der Zerfall der Sowjetunion, ihre blutigen Opfer und all die Helden Ost- und Mitteleuropas – irgendwie vergessen. Im Westen rief man „Gorbi, Gorbi!“. Der Popstar der Perestroika, der die Balten zusammenschießen ließ und in Russland gehasst wird. In Tschetschenien 1994 zerfällt das sowjetische Imperium endgültig und die Welt sieht ihm desinteressiert beim Scheitern zu.
35 Jahre nach dem Beitritt der DDR zum Staatsgebiet der Bundesrepublik scheint es nun endgültig allen im Westen zu dämmern, dass sich im Jahr 1989 auch für sie etwas geändert hat. Die Eroberung der östlichen Märkte durch westdeutsche Firmen war eine Party des Wachstums und des Wohlstands für alle. Den erfolgreichsten Aufstieg einer Volkswirtschaft legte dann China hin. Das ist so weit östlich, dass es fast wieder im Westen sein könnte und damit ein logischer Teil dieser Geschichte.
Tief unter dem Mantel dieser Entwicklung entstand ein neues Selbstbewusstsein im Osten. Ein Oststolz, welcher an der Elbe beginnt und in Shanghai endet. „Ost, Ost, Ostdeutschland“, rufen die Fans von Dynamo Dresden. „Wir aus dem Osten“, singen die Unioner. „Ost, Ost, Ostdeutschland“, grölen die „reinrassigen“ Deutschen in Bautzen. Ostdeutsch sagen auch die Intellektuellen, die Ausgewanderten, die Geflohenen, die Zurückgekehrten. Wir kommen aus dem Osten! Wir sind der Osten! Nie meinen sie die Menschen in Osteuropa mit. Die Mitte Europas liegt jedoch in Polen oder im Baltikum. Je nachdem, wie man misst. Sie liegt auf keinen Fall in Berlin, Dresden oder Magdeburg.
Jetzt gibt es also dieses Ostdeutschland. Neun bis zwölf Millionen Menschen, welche sich selbst als Ostdeutsche bezeichnen, sind irgendwie auf etwas stolz, was es so bis vor 30 Jahren noch nicht gab. „Gelernte DDR-Bürger“ lautet eine Selbstbezeichnung. Bürger waren wir sicher nicht. Bürger mischen sich ein, sie haben ein individuelles politisches Bewusstsein. Bürger war man östlich der Elbe vor 1989 nie. Erst lebte man in Preußen, dann in einem totalitären Terrorstaat und zum Schluss in der DDR. Wir waren Deutsche in einem getrennten Staat. Für die Osteuropäer waren wir die aus dem Westen. Ostdeutsch sind wir erst seit Kurzem.
Aus dem Osten sein bedeutet vielleicht, in permanenten Widersprüchen zu leben. Widersprüche, die nie aufgelöst wurden. Widersprüche, die in seltsamen Erzählungen über ein Selbst und ein Früher münden, die es so wohl niemals gab.
Im Dezember 1989 sprühten Unbekannte auf das sowjetische Ehrenmahl in Treptow: „Sprengt das letzte Völkergefängnis. Sprengt die UdSSR. Nationalismus. Für ein neutrales Deutschland. Für ein Europa freier Völker. Besatzer raus.“ Hunderttausende demonstrierten am 3. Januar 1990 gegen den Faschismus. Gerufen hatte sie die SED. Die Partei, der sich die Ostdeutschen gerade entledigten. Sie demonstrierten letztlich gegen die Osteuropäer und deren Wunsch, sich aus dem russischen Völkergefängnis zu befreien. Ein Gefängnis, das sie selbst zu Hunderttausenden verließen, über eben jene Länder, denen sie die Freiheit mit diesem Bekenntnis absprachen. Sie warfen den Verfassern der Sprühaktion vor, Nazis zu sein. Ein ironischer Vorbote der Zukunft. Denn heute enthält Kritik an den Ostdeutschen oft den Vorwurf, Nazis zu sein.
Geschichten aus dem Osten sind letztlich Briefe aus der Zukunft an den Westen. Briefe, in denen man lesen kann, wie ein Westeuropa der Zukunft sein wird. Viktor Orbán schickte mehrere Briefe an die EU mit dem klaren Hinweis, dass Demokratie neu definiert wurde. Polen bezeichnet sich selbst als Frontstaat und gibt fünf Prozent seiner Wirtschaftsleistung für die Verteidigung aus. Das Baltikum schickt keine Briefe, sondern digitale Nachrichten aus einer digitalen Verwaltung. Veraltete Gesellschaften voller Männerüberschuss streben die Diktatur der Mehrheit an und stellen infrage, dass Minderheiten dazugehören sollten. Geschichten über Deindustrialisierung wurden geschrieben. Also so richtige Deindustrialisierung. Nicht der aktuelle Panikbegriff der Westdeutschen, wenn erstmalig ein bis drei VW-Werke schließen sollen. Der Osten erzählt von einer Transformation in eine Dienstleistungsgesellschaft. In der Ukraine wurde ein ganzes Volk kriegstüchtig. Es begriff, dass Frieden ohne Freiheit kein Frieden ist. Es sendet uns diese klare Botschaft. Währenddessen singen 50 Prozent der Ostdeutschen „Kleine weiße Friedenstaube“.
Zukunft ist das, was wir uns über die Zukunft vorstellen. Jeder hat seine eigene. Deshalb gibt es einen Plural von Zukunft. Im Osten wurde eine Zukunft für Westeuropa bereits Realität. Eine Realität, die eben nicht das Ende der Geschichte war. Fukuyamas Traum ist aus.
Paul Bäumer fiel im Jahr 1918. Es war so ruhig und still an diesem Tag im Westen, dass der Heeresbericht nichts Neues vermeldete. Im Osten dagegen tobte die kommunistische Revolution. Eine Revolution, die die Welt für immer verändern sollte. Die neue Weltordnung begann im Osten.
Heute wird die Welt wieder neu geordnet. Es werden Jahrzehnte voller Chaos, Krieg, Veränderungen und Widersprüchen folgen. Die Medien geraten in Panik. Sie schreiben dieser Tage: „Trump ist gewählt, China wird selbstbewusst. Die Welt stürzt zusammen. Nichts wird wohl so bleiben, wie es ist.“ Im Osten nichts Neues!
„Im Osten nichts Neues“ von Daniel Heidrich: alle Kolumnen auf einen Blick.