Iris Bethge-Krauß, Hauptgeschäftsführerin und geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V., ist eine wichtige Impulsgeberin für Ostdeutschland. Sie setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist sie auch im zweiten Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.
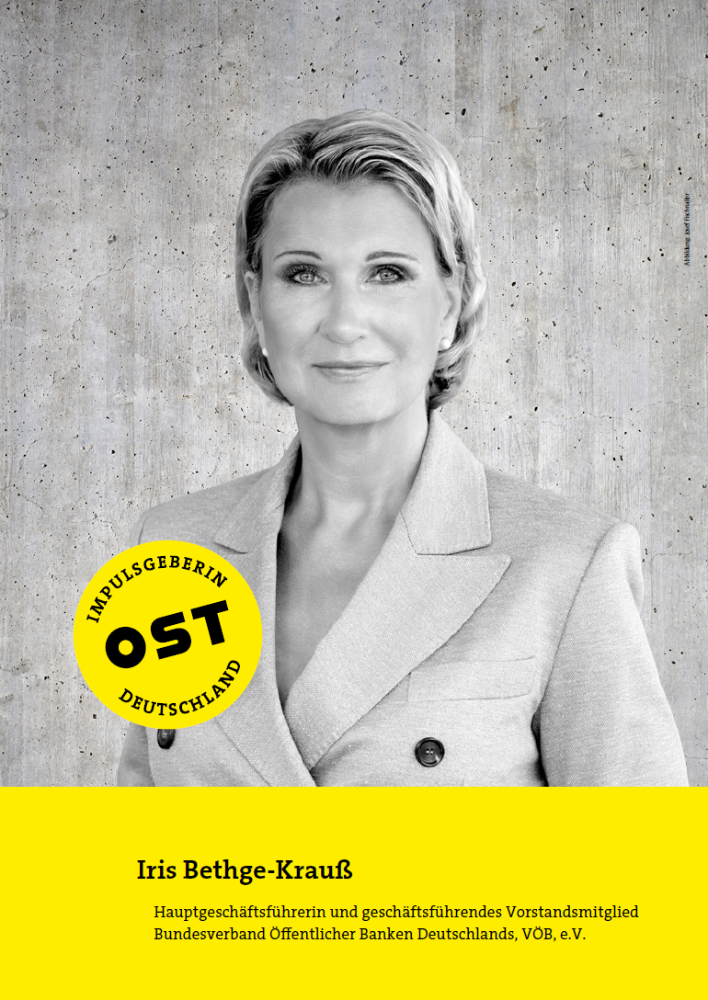
Iris Bethge-Krauß, Hauptgeschäftsführerin und geschäftsführendes Vorstandsmitglied Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V. Abbildung: Josef Fischnaller
Vor über 35 Jahren brachten die Bürgerinnen und Bürger der DDR das damalige SED-Regime samt der Berliner Mauer zu Fall. Ihr Mut war es, der die deutsche Wiedervereinigung ermöglichte – und den Weg frei machte, die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebensverhältnisse zwischen Ost und West anzunähern. In Deutschland gelang mit dem sogenannten „Aufbau Ost“ eine historisch beispiellose Transformation von gigantischem Ausmaß. Aus einer zentralistischen Planwirtschaft wurde eine dezentrale Marktwirtschaft.
In den ersten 30 Jahren nach der deutschen Einheit flossen nach verschiedenen Schätzungen circa 300 bis 350 Milliarden Euro als strukturpolitische Transferzahlungen (ohne Sozialtransfers) in die neuen Länder. Anfangs, bis Mitte der 1990er-Jahre, machten sie jährlich rund 70 Prozent der inländischen Wirtschaftsförderung aus. Die Mittelvergabe übernahmen vielfach die Förderbanken von Bund und Ländern. Allein von der KfW erhielten Wirtschaft, Privatpersonen und Kommunen in Ostdeutschland fast 200 Milliarden Euro Investitionskredite für Unternehmensfinanzierungen, Existenzgründungen, die Sanierung der kommunalen Infrastruktur und die Modernisierung des Wohnungsbestands.
Wichtigste Finanzierungsquellen für die Fördermittel beim Aufbau Ost waren der Fonds „Deutsche Einheit“, die Solidarpakte I und II sowie das bereits seit 1969 in der alten Bundesrepublik bestehende Programm Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA). Für die ostdeutschen Länder gilt Letzteres als wirksamstes und erfolgreichstes Programm in der Wirtschaftsförderung. Mit der GA konnte jedes Bundesland eigene regionale oder inhaltliche Investitions- und Förderschwerpunkte setzen, um Standortnachteile auszugleichen und die Wettbewerbsfähigkeit von Industrie und Mittelstand vor Ort zu stärken. Zudem wurden die fünf neuen Bundesländer in den gesamtdeutschen Länderfinanzausgleich einbezogen und erhielten darüber hinaus Sonderleistungen des Bundes für Investitionen in Infrastrukturprojekte, die Wirtschaftsförderung, für Sanierungen und Soziales. Ergänzend dazu nutzten die Förderbanken EU-Strukturfonds sowie Garantien der Europäischen Investitionsbank. Wichtig für den Aufbau Ost waren zudem die Mittel aus dem ERP-Sondervermögen (European-Recovery-Programme), die ab 1990 auch in die neuen Länder flossen. Sie konnten für Förderungen der deutschen Wirtschaft eingesetzt werden, die die Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit der Unternehmen steigerten. So konnten im ersten Jahrzehnt nach dem Fall der Mauer 65.000 Unternehmen in den neuen Ländern KfW-Kredite in Gesamthöhe von über 25 Milliarden Euro für ihre Investitionen bekommen – und damit 2,5 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder erhalten.
Mit ihren Förderprogrammen haben die deutschen Förderbanken maßgeblich zur erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung in Ostdeutschland beigetragen.”
Förderbanken mit passgenauen Lösungen
Zu den ostdeutschen Förderinstituten zählen die Investitionsbank Berlin (IBB), die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), die Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB), das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (LFI), die Sächsische Aufbaubank (SAB) sowie die Thüringer Aufbaubank (TAB). Sie arbeiten mit Banken und Sparkassen zusammen und kooperieren mit der bundesweit tätigen KfW-Bankengruppe, der Landwirtschaftlichen Rentenbank sowie der Europäischen Investitionsbank.
Während die IBB aus der in Westberlin ansässigen Wohnungsbau- Kreditanstalt hervorgegangen ist, sind die übrigen Förderbanken der neuen Bundesländer erst nach der deutschen Wiedervereinigung entstanden. Sie wurden in den frühen 90er-Jahren als landeseigene Institute gegründet oder begannen als Geschäftsbereiche bzw. Tochtergesellschaften von westdeutschen Landesbanken oder Förderbanken.
Die Übernahme des westdeutschen Förderbankenmodells in Ostdeutschland erfolgte auch, weil sich die Förderung mit Bankinstrumenten als effektiver erweist. Durch die Möglichkeit der Kreditvergabe – die nur Banken erlaubt ist – kann mit begrenzten öffentlichen Mitteln ein deutlich höheres Fördervolumen erzielt werden als beispielsweise durch die Auszahlung von Zuschüssen. Damit können Förderbanken in der regionalen Strukturentwicklung deutlich mehr bewirken.
Heute agieren die ostdeutschen Förderbanken in unterschiedlichen Rechtsformen eigenständig und wettbewerbsneutral. Ähnlich wie bei den westdeutschen Förderbanken hat sich ihr Förderspektrum sukzessive erweitert. Die Modernisierung und Entwicklung der ehemaligen DDR-Regionen erforderten mehr als nur Wohnraumund Infrastrukturförderungen. Die Förderung von gewerblichen Investitionen war genauso erforderlich wie Existenzgründungsförderungen und die kommunale Förderung. Hinzu kamen unter anderem Städtebauförderung, Dorfentwicklung sowie der Aufbau von Regionen- und Branchen-Netzwerken. Auch die Unterstützung des Strukturwandels, etwa in den ehemaligen Braunkohleregionen in Brandenburg und Sachsen, zählt heute zu den Kernaufgaben der ostdeutschen Förderbanken.
Die Förderbanken haben sich als wirkungsvoller Stabilitätsfaktor etabliert. Sie kennen die Bedürfnisse vor Ort und können flexibel passgenaue Lösungen für ihre Heimatregionen anbieten. Sie haben Zugang zu den Fördertöpfen von EU, Bund und Ländern und stellen Fördermittel in Form von Förderdarlehen, Zuschüssen und Garantien zur Verfügung. Im Jahr 2024 wurden gemäß einer Zusammenstellung des VÖB von den deutschen Förderbanken in den ostdeutschen Bundesländern (einschließlich Berlin) rund 10,4 Milliarden Euro an Förderdarlehen vergeben. Ein Großteil davon waren gewerbliche Förderungen sowie Mittel für den Wohnungs- und Städtebau. Das Gesamtvolumen an bewilligten Zuschüssen, also nicht rückzahlbaren Zuwendungen, belief sich auf 6,4 Milliarden Euro. Diese Zahlen zeigen die große Bedeutung, die die Förderbanken nach wie vor für die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland haben.

Die ostdeutschen Förderbanken haben mit ihren Förderprogrammen entscheidend zur Transformation der ostdeutschen Wirtschaft beigetragen. Abbildung: VÖB, e.V.
Ostdeutschland als Zukunftsregion
Mit ihren Förderprogrammen haben die deutschen Förderbanken maßgeblich zur erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung in Ostdeutschland beigetragen. Die ostdeutsche Wirtschaftsleistung, gemessen am realen BIP pro Kopf, ist von ursprünglich rund der Hälfte des westdeutschen Niveaus auf mittlerweile knapp 80 Prozent und in manchen Regionen Ostdeutschlands auch darüber hinaus gewachsen. Entscheidend für diesen Aufholprozess war eine umfassende Modernisierung der Infrastruktur, aber auch die Entwicklung neuer Forschungs- und Wirtschaftscluster sowie die Ansiedlung von Fertigungs- und Umschlagsstandorten unter anderem aus der Automobil-, Technologie- und Logistikwirtschaft.
Mittelständisch geprägte kleine und mittelgroße Unternehmen bilden heute eine solide und moderne Basis der ostdeutschen Wirtschaft. Allerdings mangelt es häufig an dort gewachsenen Großunternehmen. Dies mag auch ein Grund für die im Vergleich zu Westdeutschland noch vorhandene Lücke in der Wirtschaftsleistung sein.
In der Wahrnehmung der Menschen in Ostdeutschland zeigt sich allerdings ein kritischeres Bild. Ostdeutsche sehen sich vielerorts nicht auf Augenhöhe mit Westdeutschen. Tatsächlich sind Spitzenpositionen in der Wirtschaft noch immer häufig mit Managern mit westdeutschem Hintergrund besetzt. Auch bei Einkommen und Vermögen bleibt der Osten unter Westniveau. Allerdings entwickelt sich Ostdeutschland bei einigen Wirtschaftsindikatoren seit geraumer Zeit besser als der Westen. Beschäftigung und Produktivität nehmen zu, die Einkommen steigen teilweise sogar stärker als im Westen. Die Angleichung der Lebensverhältnisse dauert allerdings deutlich länger als Anfang der 1990er-Jahre erwartet. Und die wirtschaftlichen Verwerfungen in den Nachwendejahren prägen weiterhin die Erinnerung und trüben die insgesamt positive Entwicklung. Ein Effekt, den sich Populisten zunutze machen.
Nicht zuletzt deshalb sollten wir den Menschen die positiven Entwicklungen und Fortschritte ins Bewusstsein rücken, indem wir sie spürbar und erlebbar machen, zum Beispiel durch Integration, Beteiligung und Mitgestalten. Dazu gehört es auch, mehr Ostdeutsche in Führungspositionen von Unternehmen zu bringen.
In den vergangenen 35 Jahren haben Förderprogramme entscheidend zur Transformation der ostdeutschen Wirtschaft von der Plan- zur Marktwirtschaft beigetragen. Parallel dazu ist auch das System der Förderbanken gewachsen. Heute verfügt Deutschland über eine dezentrale und verlässliche Förderbankenlandschaft. Im Auftrag ihrer öffentlichen Eigentümer setzen die Förderbanken wirtschaftspolitische Maßnahmen mit bankmäßigen Mitteln effizient um und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft. Ihre Bedeutung haben sie nicht nur während der Coronapandemie unter Beweis gestellt. Förderbanken sind weit mehr als Krisenhelfer – sie gestalten aktiv den Wandel und ermöglichen Fortschritt, indem sie große gesellschaftliche Projekte vorantreiben.
Die deutsche Förderpolitik mit ihrem System der Förderbanken hat sich als effizient und wirkungsvoll erwiesen – das zeigen die Ergebnisse des größten Transformationsprogramms in der Geschichte unseres Landes eindrucksvoll. Die Förderbanken waren und sind ein maßgeblicher Treiber für Fortschritt und Wandel. Sie haben damit wesentlich zur wirtschaftlichen Angleichung zwischen Ost und West beigetragen.
Diese Erfahrung, diese Kompetenz und diese Wirkungskraft gilt es nun für die nächsten großen Transformationen zu nutzen: die ökologische und die digitale Transformation sowie den demografischen und den geoökonomischen Wandel. Sie erfordern umfassende Investitionen, damit Deutschland und Europa auch künftig wettbewerbsfähig bleiben. Doch es geht um mehr als Wettbewerbsfähigkeit – es geht darum, unsere gemeinsamen Werte zu bewahren und den Wohlstand und Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu sichern. Dafür stehen der VÖB und seine Mitglieder.
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.
GEGRÜNDET: 1916 (als Verband Deutscher Öffentlich-Rechtlicher Kreditanstalten)
STANDORT: Berlin
MITARBEITENDE: circa 80
WEBSITE: voeb.de
Iris Bethge-Krauß
GEBOREN: 1969/Dannenberg (Elbe)
WOHNORT (aktuell): Berlin
 BUCHTIPP: BUCHTIPP:
„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Auch dieser zweite Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die weiteren 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Band 2, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2025, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |





























