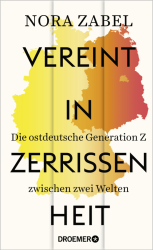Nora Schmidt-Kesseler, die Hauptgeschäftsführerin vom Verband der Chemischen Industrie e.V., Landesverband Nordost, ist eine wichtige Impulsgeberin für Ostdeutschland. Sie setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist sie auch in dem Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.

Nora Schmidt-Kesseler, Hauptgeschäftsführerin, Verband der Chemischen Industrie e.V., Landesverband Nordost. Abbildung: Annette Koroll
Schönheit ist überall in Ostdeutschland zu finden, von den majestätischen Gebirgen des Harzes bis zu den idyllischen Seen der Mecklenburgischen Seenplatte. Mein allererster Besuch in Ostdeutschland führte mich nach Potsdam. Ich sah eine Stadt im Dornröschenschlaf: die Häuser grau, die Straßen in schlechtem Zustand. Dennoch waren die Reize Potsdams auf Schritt und Tritt zu erahnen – seine architektonische Pracht, seine Kunstschätze und reiche Geschichte. In den folgenden Jahren kehrte ich immer wieder nach Potsdam zurück und konnte so mitverfolgen, wie die Stadt nach und nach erblühte. Historische Altbauten erstrahlten in neuem Glanz, die Infrastruktur wurde modernisiert, das kulturelle Leben begann wieder zu florieren. Die Wiederherstellung Potsdams – für mich ist sie eines der faszinierendsten Zeugnisse der deutschen Wiedervereinigung.
Ich habe nach der Wende noch viele andere ostdeutsche Städte und Landstriche bereist. Und ich sah, wie auch dort die Menschen ihre ganze Energie und Hoffnung in den Wiederaufbau und die Modernisierung ihrer Gemeinden steckten. Ähnliches spielte sich an den Industriestandorten ab. Anlagen wurden runderneuert oder umgewidmet, um den Bedürfnissen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden. Technologische Innovationen und eine wachsende Wirtschaft brachten Arbeitsplätze und Wohlstand in die Regionen.
Mit den neuen Chancen hielten neue Herausforderungen Einzug. Kulturelle und ökonomische Unterschiede zwischen Ost und West traten zutage und sorgten für Spannungen. Die Überforderung vieler Menschen unter dem Druck des abrupten politischen Systemwechsels wie auch Fragen sozialer Gerechtigkeit kamen aufs Tapet. Was mich bis heute beeindruckt: Bei allen Schwierigkeiten, die die Wiedervereinigung mit sich brachte, waren die Deutschen fest entschlossen, gemeinsam voranzukommen. Sie wollten die Kluft überbrücken, die jahrzehntelang zwischen beiden Teilen des Landes bestanden hatte.
Dem unbedingten Gestaltungswillen der Ostdeutschen ist es zu verdanken, dass auch der Chemieindustrie ein beispielloser Kraftakt der Selbsterneuerung gelang.”

Unterstützung von Bildungseinrichtungen mit Masken und Desinfektionsmittel in der Corona-Hochphase. Abbildung: VCI Nordost
Vorzeigeindustrie mit Schattenseiten
Diesem unbedingten Gestaltungswillen der Ostdeutschen ist es zu verdanken, dass auch der Chemieindustrie ein beispielloser Kraftakt der Selbsterneuerung gelang. Um ihn in seiner ganzen Dimension zu ermessen, müssen wir uns die Geschichte des Wirtschaftszweigs vergegenwärtigen. Schon im Deutschen Kaiserreich war die Chemieindustrie tief in der Region verwurzelt. Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Maschinen entweder zerstört oder demontiert worden waren, stand der Osten vor dem Nichts. Das erkannte die SED-Führung und beschloss auf ihrem fünften Parteitag im Jahr 1958 das Chemieprogramm der DDR. „Chemie gibt Brot, Wohlstand, Schönheit“ war von nun an der Leitspruch der Parteiagitation.
Chemieerzeugnisse hatten einen hohen Stellenwert. Kraftstoffe, Düngemittel, Waschmittel, Textilien – alles sollte wie im Westen verfügbar sein. Außerdem galten sie als Devisenbringer. Chemiewerke wie Leuna und Buna wurden ausgebaut, neue Anlagen in Schwedt oder Böhlen errichtet. Da die DDR keine eigenen Erdölvorkommen besaß, wurde zusätzlich die Pipeline „Freundschaft“ (Druschba) verlegt.

Gemeinschaftliches Engagement für Chemie-Azubis mit unserem Sozialpartner IGBCE. Abbildung: VCI Nordost
Strukturumbau statt Strukturbruch
Auch wenn der ökologische Preis dafür hoch war. Die Chemieindustrie stellte einen der bedeutendsten Wirtschaftszweige der DDR dar. Noch im Jahr vor der Wende hatte die Branche umgerechnet über zwölf Milliarden Euro Umsatz erzielt. Mit dem Fall der Mauer änderte sich die Situation schlagartig. Währungsunion und Wiedervereinigung stürzten die gesamte Wirtschaft in den damals neuen Bundesländern in eine tiefe Krise. Die bis dahin staatlich gelenkte Chemieindustrie traf es mit voller Härte. Konfrontiert mit dem freien Spiel der Kräfte an den internationalen Märkten, offenbarte sich, wie marode die meisten ostdeutschen Betriebe waren. Der Außenhandel mit den Ostblockstaaten brach zusammen, der Umsatz schrumpfte auf unter sechs Milliarden Euro, die angestammten Standorte lagen am Boden. Heruntergekommene Fabriken und erschütternde Umweltaltlasten bestimmten das Bild von der ostdeutschen Chemie. An globale Wettbewerbsfähigkeit war nicht zu denken. Eine Deindustrialisierung schien naheliegend.
Für die Menschen bedeutete dies unvorstellbar harte Einschnitte. Zehntausende verloren in den Nachwendejahren ihren Job, Massenarbeitslosigkeit war die Folge. Von vormals 193.100 Beschäftigten standen 1999 nur noch 40.000 Menschen in der Ostchemie in Lohn und Brot.
Doch von diesem Tiefpunkt aus nahm eine bemerkenswerte Transformation ihren Ausgang. Ungeachtet aller Zumutungen, die der politische Umbruch für viele Ostdeutsche mit sich gebracht hatte, war die Aufbruchstimmung mit Händen zu greifen. Bereits Anfang der 1990er-Jahre hatte eine regelrechte Gründungswelle viele Branchen Ostdeutschlands erfasst. In deren Sog konnten sich schließlich auch kleine und mittelständische Familienbetriebe ebenso wie die großen Unternehmen und Anlagenbetreiber der Chemie unter neuer Eigentümerschaft erholen.
Was war ausschlaggebend für dieses ostdeutsche „Wirtschaftswunder“? Einerseits unterstützte die Regierung die chemisch-pharmazeutischen Unternehmen; nicht nur durch Fördermittel, sondern auch, indem sie wirksame Rahmenbedingungen zum Erhalt der industriellen Kerne in Mitteldeutschland schuf. Die Anerkennung für die Schlüsselindustrie Chemie durch die damalige Politik war allerorten zu spüren. Chemiebeschäftigte genossen in der Region Respekt und Anerkennung. Zwar wanderten viele in die alten Bundesländer ab, doch noch mehr sind geblieben und haben unter hohem persönlichem Einsatz die Betriebe wieder nach vorn gebracht. Der Standort Ostdeutschland erwies sich dabei schon bald als Vorteil, denn er war aufgrund seiner Lage zur Produktion im großen Stil geeignet. Mit der Öffnung der Europäischen Union nach Osteuropa rückte Mitteldeutschland vom Rand ins Zentrum des Kontinents und wurde zur Drehscheibe der west- und osteuropäischen Märkte.
Nicht zu vergessen: Zwischen 1991 und 2018 investierte unsere Branche mehr als 27 Milliarden Euro in Sachanlagen. Das sorgte nicht nur für eine effizientere Produktion und eine Steigerung des Wohlstandes im Osten. Emissionen wurden nachhaltig gesenkt, Altlasten dank innovativer Methoden erfolgreich bekämpft und die Landschaften deutlich aufgewertet. Allen Hürden und manchen Prognosen zum Trotz hat die Chemieindustrie in Ostdeutschland den Übergang von der Planwirtschaft in die Marktwirtschaft bewältigt. Als einer der zentralen Sektoren ist es ihr gelungen, einen Strukturbruch abzuwenden und den Strukturwandel aktiv mitzugestalten.

Im August 2022 bei einer Podiumsdiskussion der Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) in Halle (Saale). Abbildung: VCI Nordost
Grüne Transformation
Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende erzählt. Denn längst ist das nächste Kapitel aufgeblättert. Deutschland und Europa haben den Weg zu Klimaneutralität eingeschlagen. Energie, Transport, Grundstoffe – alle Bereiche stehen vor gewaltigen Umbrüchen. Um die grüne Transformation zu meistern, braucht die Chemieindustrie einmal mehr Zukunftsmut, Veränderungsbereitschaft und Innovationskraft.
Die strukturellen Voraussetzungen in Ostdeutschland sind hervorragend. Große Mengen an Strom werden bereits aus erneuerbaren Energien erzeugt. Der Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur schreitet voran und zieht weitere Zukunftstechnologien an. Wichtige Schauplätze des Transformationsgeschehens bilden die Chemieparks, wo neue Ideen entstehen und an Branchenlösungen zur Dekarbonisierung des Sektors gearbeitet wird. Neben den etablierten Unternehmen siedeln sich Start-ups an, die von der hervorragenden Forschungslandschaft in der Region profitieren. So entsteht ein dynamisches Ökosystem für Innovationen in der Chemie.
Was schon alles möglich ist, kann man in Ostdeutschland an gleich mehreren Orten bestaunen: etwa in Gestalt der weltweit ersten Bioraffinerie in Leuna, am Standort Bitterfeld-Wolfen, wo neuerdings erstmals in Kontinentaleuropa Lithiumhydroxid in Batteriequalität veredelt wird, oder in Schwarzheide, das mit einem Zentrum für Batteriematerialproduktion und Batterierecycling aufwartet.

Ein Leuchtturm der Tarifbindung und Sozialpartnerschaft, auch in Zeiten von Tarifverhandlungen. Abbildung: VCI Nordost
Das Zuhause der Chemiezukunft
Leuchttürme wie diese machen mich zuversichtlich, dass unsere Branche auch aus der zweiten großen Transformation ihrer Geschichte gestärkt hervorgehen wird. Und sie sind die Basis für Brot und Wohlstand. Zur Erinnerung: Ostdeutschlands Chemieindustrie hat es geschafft, sich nach der Wiedervereinigung zu konsolidieren. Mit heute etwa 31 Milliarden Euro Umsatz und rund 56.000 Beschäftigten ist sie der drittgrößte Industriezweig und bietet einige der attraktivsten Arbeitsplätze sowie höchste Gehälter in Ostdeutschland. Der Anteil der beschäftigten Frauen liegt fünf Prozentpunkte über dem deutschen Durchschnitt.
Aufbauend auf diesem ungeheuren Erfolg, wird die ostdeutsche Chemieindustrie dem Wandlungsdruck ein weiteres Mal standhalten. Die Herausforderungen sind dabei nicht allein technologischer Natur. Für die mehr als 300 überwiegend kleinen und mittelständischen Betriebe wird entscheidend sein, den Übergang in die nächste Generation zu bewältigen. Denn viele Familienunternehmer haben ihre Firmen in den 1990er-Jahren gegründet und gehen nun auf den Ruhestand zu.
Doch ich denke an Potsdam, diese einst so graue und heute malerische, prosperierende Stadt, und ich bin mir sicher: In Ostdeutschland – wo übrigens das Wort Chemie nach wie vor anders ausgesprochen wird als im Rest der Republik, nämlich schnörkellos und ohne Kehlkopfverrenkungen –, in dieser im besten Sinne eigensinnigen und immer noch unterschätzten Region also, hat die Chemiezukunft ein Zuhause. Denn hier wissen die Menschen: Große Herausforderungen sind da, um sie zu lösen, nicht um zu verzagen.

#JazuEuropa: Chemiekampagne zur Europawahl und gemeinsamer Aufruf mit Ministerpräsident Reiner Haseloff. Abbildung: Jens Schlüter
Verband der Chemischen Industrie e.V., Landesverband Nordost
GEGRÜNDET: 1950
STANDORTE: Berlin, Halle (Saale), Dresden
MITARBEITENDE: 22
WEBSITE: nordostchemie.de
Nora Schmidt-Kesseler
GEBOREN: 1967/Völklingen
WOHNORT (aktuell): Berlin
MEIN BUCHTIPP: Mathias Bertram (Hg.): „Das pure Leben. Fotografien aus der DDR. Die frühen Jahre 1945–1975“, 2014
 BUCHTIPP: BUCHTIPP:
„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Dieser Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2024, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |