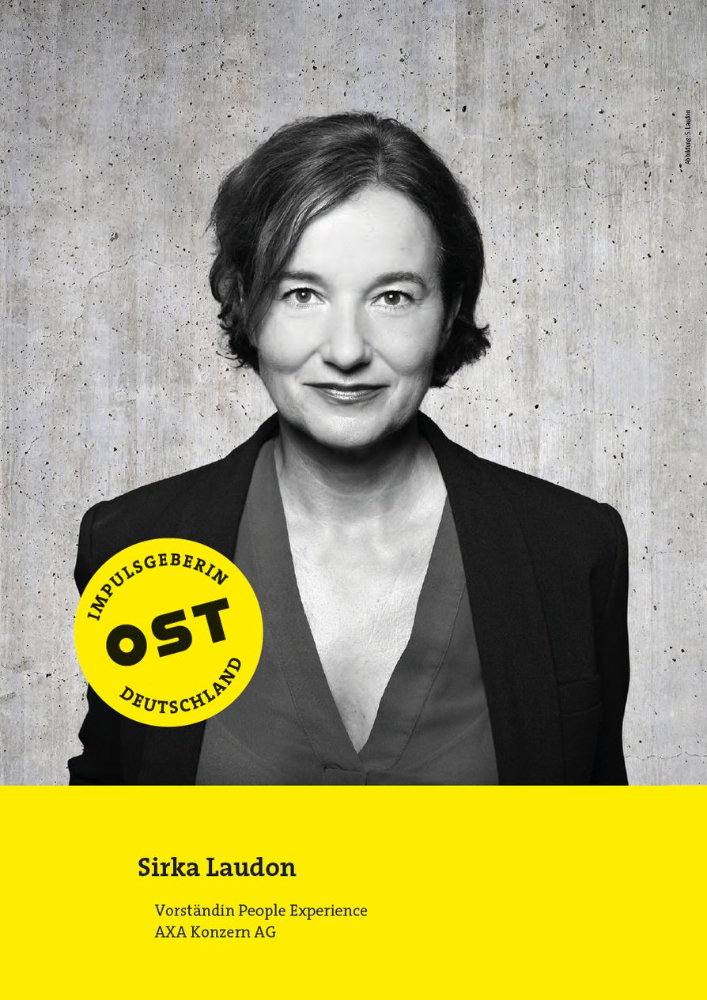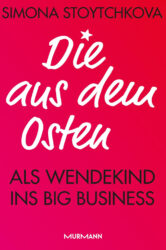Sirka Laudon, die Vorständin People Experience der AXA Konzern AG, ist eine wichtige Impulsgeberin für Ostdeutschland. Sie setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist sie auch in dem Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.
Der erste Begriff, der mir in den Sinn kommt, wenn ich an meine Jugend in Ostdeutschland denke: lebendige Kreativität. Wie bei allen Jugendlichen sollte meine erste Wohnung cool sein, die Klamotten lässig, die abendlichen Aktivitäten inspirierend. Nichts davon gab es „von der Stange“ und leicht zu erreichen. Ärgerlich damals. Großartig heute – im Rückblick.
Meinen 18. Geburtstag habe ich in meiner Ein-Zimmer-Wohnung in Berlin, Prenzlauer Berg, gefeiert. Zweiter Hinterhof. Ein Kohleofen, der nicht verhindern konnte, dass das Leitungswasser im Winter manchmal gefror. Ein provisorisches Waschbecken in der Speisekammer der Küche fungierte als Badezimmer. Immerhin: Innentoilette. Am Geburtstag tranken wir Apfelwein und tanzten zwischen alten Möbeln und Bücherstapeln zur Musik aus dem Kassettenrekorder. Genauso hatte ich mir mein Leben in seiner besten Version vorgestellt.
Wenn die begehrten Dinge des Lebens einfach verfügbar gewesen wären, hätte ich mir manche Anstrengung erspart – hätte mich jedoch auch um manches Abenteuer gebracht. Auf abendlichen Streiftouren durch Abrisshäuser habe ich Möbelschätze gefunden, die die Bewohner in Vorfreude auf ihre Einbauküchen in Plattenbauten zurückgelassen haben. Meine Nähmaschine ratterte Tag und Nacht, um aus bonbonfarbenen Bettlaken und XXL-Damenunterhosen Sweatshirts, Kleider und extravagante Stücke zu schneidern. An das einzigartige Gefühl, morgens um drei endlich das begehrte Kleid aus der Nähmaschine und damit drei Stunden später auf dem Arbeitsweg alle Blicke auf sich zu ziehen, erinnere ich mich noch gut. Wir waren erschöpft und genervt. Aber wir waren auch immens glücklich. Ein Glücksgefühl, das nicht „von außen“ kam, sondern selbst erarbeitet, mit Anstrengungen errungen, dem Leben abgetrotzt wurde.
Mit ein paar Jahrzehnten Abstand, einem Psychologiestudium und als Personalvorständin eines Unternehmens mit 8.000 Mitarbeitenden nenne ich dieses Gefühl fachmännisch „Selbstwirksamkeitserleben“ oder „Empowerment“. Mehr noch: Wenn man in der Fachwelt zu wichtigen (Zukunfts-)Kompetenzen forscht, steht Empowerment ganz oben auf der Liste! Keine andere Kompetenz stellt uns besser für eine unsichere, sprunghafte und komplexe Zukunft auf. Stabile Wenn-dann-Zusammenhänge gelten nicht mehr, jeder Einzelne muss sich ständig neu justieren und auf die intuitiven Impulse, das Leistungsvermögen und den inneren Kompass vertrauen.
Psychologisch gesehen erlebte das Selbstwirksamkeitserleben der Wendezeit einen jähen Abbruch.”
Kollektives Selbstwirksamkeitserleben
Der innere Kompass war es, der 1989 eine ganze Nation hat aufbegehren lassen. Mit den „Wir sind ein Volk!“-Rufen traute man sich, das einzufordern, was einem die staatliche Erziehung absprach – ein selbstbestimmtes Leben wie im Westen Deutschlands. Der Bevormundung müde, den Lügen überdrüssig taumelte eine ganze Nation einem anderen Leben entgegen. Mutig. Freudvoll. Entschlossen. Um dieses kollektive Selbstwirksamkeitserleben haben uns andere Nationen beneidet.
Im Rückblick finde ich diese Entwicklung immer noch sehr überraschend. Was hat diese Energien entfacht? Wie war diese Emanzipation möglich? Ein Land, das autoritär-hierarchisch gesteuert jegliches Aufbegehren in subversive Strukturen verbannte. Ein Land, das fehlende demokratische Strukturen und materielle Armut in eine Art innerseelische Demokratie und Beziehungsstruktur übersetzte, befreit sich aus eigenen Kräften. Wenn ich als Psychologin mit dem Empowerment-Konzept auf diese Entwicklung schaue, war 1989 vielleicht das einzige Zeitfenster für diese friedliche Revolution: Es gab Gorbatschow mit der Perestroika-und-Glasnost-Bewegung in der Sowjetunion als Mut machendes Vorbild. Es gab ein Volk, das sich stark an westlichen Ideen, Moden und Entwicklungen orientierte und nicht vollends die ohnmächtige Zuschreibung „Es hilft ja doch alles nichts“ akzeptierte. Es gab das Selbstwirksamkeitserleben des Einzelnen in den oben beschriebenen Nischen und eine lebendige Beziehungskultur, die nicht durch Vereinzelung oder Materialismus korrumpiert wurde. Die Menschen waren innerlich wach. Ja, hellwach.
Anstrengung in der Sackgasse
Psychologische Studien belegen, dass Empowerment einer Anstrengung bedarf, um sich als Erfahrung und Erlebnis in den Körper einzuschreiben. Gut beobachten lässt sich das beim Spielen von Erwachsenen mit ihren Kleinsten. Sobald die Kleinen mühsam zum Spielzeug hin robben müssen, ist der wohlmeinende Erwachsene oft versucht, dem Kind das begehrte Objekt entgegenzustupsen. Gut gemeint, aber schlecht für das Selbstwirksamkeitserleben des Kindes. Sich gegen widrige Umstände zu behaupten und ein hohes emotionales Involvement, zum Beispiel im beglückenden Gefühl ausgedrückt, etwas Schwieriges erreicht zu haben, führen zu einer hohen Ausbildung von Selbstwirksamkeitserleben.
Wir als Gesellschaft? Wie ist es um unser Anstrengungsverhalten bestellt? Wie sehr schaffen wir es, Genugtuung aus den Dingen zu ziehen, die uns einmal Freude verschafft haben: die eingekochte Rhabarbermarmelade, die selbst tapezierte Wohnung, der Abend mit Freunden am Küchentisch? Wie sehr glauben wir, dass wir alles erreichen können, wenn wir wollen? Wie weit reicht das Selbstwirksamkeitserleben?
In letzter Zeit werde ich häufiger mit folgender Statistik konfrontiert: Nur 4,3 Prozent der Menschen mit Ostbiografie sind in Führungspositionen der deutschen Wirtschaft angekommen („Elitenmonitor“ der Bundesregierung, 2022). Bei einem Anteil von knapp 20 Prozent an der Gesamtpopulation sind die Ostdeutschen in Entscheidungspositionen der Wirtschaft deutlich unterrepräsentiert. Bei Erklärungsversuchen für diese Unterrepräsentation bin ich auf Spezifika der Wirtschaft gestoßen, die es in Kultur und Politik nicht im gleichen Ausmaß gibt, weshalb die Zahlen für Repräsentanz in diesen Feldern besser aussehen. Warum haben gerade in der Wirtschaft die Menschen nicht das Gefühl, mit selbstwirksamer Anstrengung „ganz nach oben“ kommen zu können?
Schauen wir uns die Wirtschaft in der DDR an: Das ohnmächtige Gefühl der Fremdbestimmung herrschte vor. Nicht Leistung und Anstrengung führten „nach oben“, sondern das Parteibuch. Mehr noch: Mit Macht wurde in Führungspositionen nicht verantwortungsvoll umgegangen. Es ging nicht darum, Gestaltungsspielräume zu nutzen und Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich voranzubringen. Es ging um politische Propaganda, die Überwachung von politischen Abweichlern und die Aufrechterhaltung einer wirtschaftlichen Scheinstruktur in einem abgeschotteten Markt. Gleichzeitig wurde die funktionierende Privatwirtschaft in den 70er-Jahren zerstört. Auf jeden Privatunternehmer mit mehr als zehn Mitarbeitenden wurde so lange Druck ausgeübt, bis er sein Unternehmen unter staatliche Leitung stellte und es quasi der DDR vermachte. Privatwirtschaftliches Agieren wurde als kapitalistische Ausbeutung verfemt.
Nach der Wende hat die Treuhand die Geschicke bestimmt. Das führte dazu, dass die alten Funktionäre durch West-Manager ersetzt wurden. Die Überzeugung „Ich kann es durch meine Anstrengung ins Top-Management schaffen“ ist in den nachfolgenden Generationen bis heute nur unzureichend verinnerlicht. Auch meine so sozialisierte Mutter hat jeden meiner Karriereschritte mit Argwohn beäugt. Wann immer ich über die manchmal aufreibende Arbeit klagte, kam der wohlgemeinte Rat: „Na, dann geh doch lieber wieder einen Schritt zurück!“ Während meine westdeutschen Freunde sich häufig als Getriebene der Leistungserwartungen ihrer Eltern sehen, fehlen die ambitionierten Eltern bei den ostdeutschen Biografien zumeist. Darüber hinaus fehlen wirtschaftliche Netzwerke, die wegweisende Praktika vermitteln oder das Budget für das obligatorische Auslandsjahr im Studium bereitstellen.

Vorbilder für friedliche Revolutionen weltweit erinnern an die Kraft des Novembers 1989. Abbildung: S. Laudon
Biografiebrüche und ihre Wirkung
Im heutigen Ost-West-Diskurs hat sich eine Stimme etabliert: die „Dritte Generation Ost“. Sie sensibilisieren die Ost-West-Diskussion für ein Thema, das häufig ausgeblendet wird: der rasante Anstieg der Arbeitslosigkeit nach der Wende. Es sind die Kinder dieser Generation, die nach dem Freudentaumel der offenen Grenzen erlebt haben, wie sich die Welt von heute auf morgen veränderte. Die Betriebe ihrer Eltern wurden abgewickelt oder umgestellt, ihre Ausbildung und akademischen Abschlüsse wurden nur zum Teil anerkannt. Wesentliche Umschulungsmaßnahmen konnten nicht verhindern, dass bis zur Trendwende im Jahr 2005 teilweise jeder fünfte Beschäftigte im Osten arbeitslos wurde. Viele erlebten sich im neuen System – der Westen galt als Referenzrahmen – inkompetent und ernüchtert.
Der Erwartungshorizont war groß durch die von der Politik versprochenen „blühenden Landschaften“. In den kurzen Veränderungsmonaten hatten viele den utopischen Traum, ein System bauen zu können, das auch die eigene Position berücksichtigt. Stattdessen strahlte die untergegangene DDR Phantomschmerzen in das neue Leben. Psychologisch gesehen erlebte das Selbstwirksamkeitserleben der Wendezeit einen jähen Abbruch. Es ist schwierig, einen Wert in sich zu finden, wenn dieser von außen in Form von Kompetenzerleben, Ausbildungs- oder unternehmerischer Biografie abgesprochen wird. Die Kinder dieser Generation haben mit den elterlichen Biografiebrüchen gehadert. Wie werden sie ihre eigenen Karriereambitionen verfolgen und welche Rolle spielen dabei ihre Eltern?

Es gibt Erinnerungstafeln, die die „Enteignungswelle“ von Privateigentum in den 1970er-Jahren beschreiben. Abbildung: S. Laudon
Die Wendeenergie wiederbeleben
Es gibt zahlreiche Erklärungsversuche für die unterrepräsentierten Ostdeutschen in Führungspositionen. Repräsentanz ist jedoch das Herzstück einer Demokratie. Sie ist der Kitt, der allen das Gefühl gibt, „mit am Tisch zu sitzen“. Die Wirtschaft kann die Kompetenzen der Menschen mit ostdeutscher Biografie dringend brauchen: Lebendige Kreativität und der Blick für die Potenziale, die in einer Sache stecken und die es mit „Hands-on-Mentalität“ und unternehmerischem Geschick zu wecken gilt, sind unbezahlbar. Anstrengungsbereitschaft und Selbstwirksamkeitserleben, die ein ganzes Volk im Jahr 1989 in einen Wendewillen versetzten, würden unsere Gesellschaft in den aktuellen Krisenzeiten zum „Anpacken“ motivieren und ihr guttun. Wir sind ein Volk, das sich aus Ohnmacht und Lähmung befreien kann. Darauf können wir vertrauen! Diese Ressource wiederzubeleben und für eine gute Zukunft einzusetzen, dafür lohnt es sich anzutreten! Wir sind ein Volk voller Potenziale.

Sirka Laudon gibt Interviews, ist gefragte Keynote-Speakerin und in diversen Jurys für HR-Awards. Abbildungen: S. Laudon
Sirka Laudon
GEBOREN: 1968/Schwerin
WOHNORT (aktuell): Berlin
MEIN BUCHTIPP: Hans-Joachim Maaz: „Der Gefühlsstau“, 1991
MEIN SERIENTIPP: „Weissensee“, 2010
MEIN URLAUBSTIPP: Ahlbeck auf Usedom
 BUCHTIPP: BUCHTIPP:
„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Dieser Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2024, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |