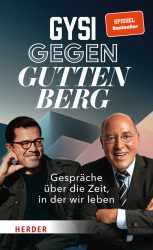Sören Pellmann, Mitglied des deutschen Bundestages, ist ein wichtiger Impulsgeber für Ostdeutschland. Er setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist er auch in dem Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.
In jenem Nachwende-Ostdeutschland voller Widersprüche rieten viele Eltern ihren Kindern, das Gegenteil von dem zu tun, was sie selbst taten. Ja, sie rieten sogar, das Gegenteil von dem zu werden, was sie selbst waren. Als ich mit 16 Jahren 1993 am Kaffeetisch in Leipzig-Grünau meiner Familie verkündet hatte, dass ich in die PDS eintrete, waren meine Eltern erst dagegen. Sie hatten beide ganz typische Wendeerfahrungen: Verlust des Arbeitsplatzes, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Abwertung der eigenen Lebensläufe. Ausgerechnet jetzt in eine linke Partei einzutreten schien nicht gerade zukunftsorientiert.
In unserer Neubausiedlung im Leipziger Westen, die im Nachwende-Neusprech jetzt verächtlich nur noch Plattenbausiedlung hieß, gab es nicht mehr viele Parteimitglieder. Die Orientierungslosigkeit der ersten Jahre nach der Wende war überall zu spüren. Wir sind auch nach der Wende in Leipzig-Grünau geblieben. Ich konnte von der Einschulung bis zum Abitur an der gleichen Schule bleiben. Bald aber leerte sich der Stadtteil rasant. 1997 wurde die Schule geschlossen, so wie viele im Osten. Vor zwei Jahren – nach über zehn Jahren Kampf auf kommunaler Ebene – konnten wir die Schule mit einem Neubau wiedereröff nen. Das macht mich regelrecht glücklich, denn meine Verbundenheit mit der Heimat hält bis heute. Irgendwie bleibt man sein Leben lang Grünauer.
Meine Jugendzeit in den mich stark politisierenden 90ern war zugleich spannend und schwierig. Diese Jahre waren einerseits knallbunt und schrill, andererseits waren sie bei uns – wie auch an vielen anderen Orten Ostdeutschlands – aufgrund von Perspektivlosigkeit, Gewalt und Auseinandersetzungen mit Rechtsextremen geprägt von Trostlosigkeit. Springerstiefel und Bomberjacken verbreiteten Angst und Schrecken für alle, die nicht in deren Bild passten. Ab Freitag nachmittags war der Jugendtreff bei uns im Gebiet besetzt von Rechten. Starke, organisierte Antirechtsbewegung und Antifa gab es damals nicht bei uns. Es gab Gegenden, in die ich nicht mehr gegangen bin. Für uns als Jugendliche war die erste Zeit nach der Wende schwer greifbar. Lehrerinnen und Lehrer, die sich plötzlich anders verhielten, Anpassungen, die wir alle ohne Kompass versucht haben zu meistern. Ich wollte aber nicht nur zusehen, sondern etwas aktiv tun, teilnehmen an Veränderungsprozessen. Ich wollte die Umbrüche mitgestalten, Demokratie mit aufbauen, mich einmischen. Ich war ein Quälgeist, der nicht so schnell lockerließ. Ich habe vieles immer wieder infrage gestellt und es meinen Lehrern und Lehrerinnen wohl nicht immer leicht gemacht. Dass ausgerechnet ich auch Lehrer geworden bin, haben mir wenige zugetraut. Und doch ist es folgerichtig. Ich glaube daran, dass, so wie ich die Dinge damals erklärt haben wollte, jeder Mensch ein Recht auf Klärung der Dinge und Erklärung der Welt hat, warum etwas so ist, wie es ist, und wie es gerade so geworden ist. Das passt doch zu einem Lehrer.
Es gab auch gute Erfahrungen, solche des Zusammenhaltens und der Solidarität untereinander. Wir haben die ersten Schülerstreiks organisiert, haben uns stark gemacht gegen rechts. Die Nachwehen des ersten Golfkriegs haben mich in meiner Antikriegshaltung geprägt. Ich habe damals politisch das Laufen gelernt.
Heute treffe ich oft auf ehemalige Schülerinnen und Schüler bei Jugendweihen oder anderen Anlässen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Trennung Ost und West 34 Jahre nach dem Mauerfall noch so eine große Rolle spielt, gerade auch bei relativ jungen Leuten. Die DDR umfasste zwei bis drei Generationen. Diese haben Erfahrungen mit zwei unterschiedlichen Systemen zu verschiedenen Zeitpunkten ihres Lebens sowie in verschiedenen Arbeitssituationen und sozialen Zusammenhängen gemacht. Dazu kommen die Menschen, die zur Wende oder danach im Osten geboren wurden und über Eltern und Umfeld in zwei Erfahrungsräumen groß geworden sind. Sie kennen zwar die DDR nicht mehr, sind aber von den Nachwirkungen des Mauerfalls und der Wende immer noch berührt. Dadurch gibt es ein oft speziell ostdeutsches Selbstbild – mit den materiellen Unterschieden, Lohnunterschieden und der immer noch herrschenden Ungleichheit bei der Anerkennung von Lebensleistungen. Es ist ein Bewusstsein dafür, dass Herkunft eben doch immer noch einen Unterschied macht.
Kein Stillstand
Heute durchleben wir wieder eine Phase des Wandels und neuer Umbrüche. In vielen ostdeutschen Gegenden sind diese Transformationsprozesse unmittelbarer spürbar als in anderen Bundesländern. Ich denke an die Lausitzregion, die gewaltige Umbrüche durchgemacht hat und bis heute mit den Folgen kämpft. Die Perspektivlosigkeit nach der Wende für Zehntausende Menschen, die in der Braunkohle gearbeitet haben, hat tiefe Spuren hinterlassen. Die ehemaligen Kohlekumpels kämpfen bis heute mit gesundheitlichen Problemen und sind auch strukturell immer noch benachteiligt, weil sie zum Beispiel bei ihrer Rentenberechnung nach wie vor schlechter gestellt sind. Wir haben in Sachsen erlebt, wie in wenigen Jahren die Hälfte der Kliniken und Arztpraxen geschlossen wurden, wie Versorgungsstrukturen weggebrochen sind.
Wir haben in den 1990er-Jahren in kürzester Zeit eine in Europa beispiellose Deindustrialisierung durch die Treuhandanstalt erlebt, die das Volkseigentum der DDR zugunsten westdeutscher Unternehmen verteilte, Industriezweige abwickelte sowie Wertschöpfungspotenziale und Einnahmen in den Westen umleitete. Es ist durchaus legitim, diesen Aneignungsprozess als eine riesige kollektive Enteignungsphase zuungunsten der ehemaligen DDR-Bevölkerung zu bezeichnen. Es wären ja durchaus Alternativen möglich gewesen. Von vorrangiger Übertragung von Grundstücken und Betrieben an Ostdeutsche bis hin zu günstigen Startkrediten für neue einheimische Unternehmen. Solche Wege waren jedoch gar nicht gewünscht.
Die ostdeutschen Länder sind mittlerweile aus der Nachwendezeit herausgetreten. Eine neue Phase der Entwicklung hat begonnen. In den letzten Jahren wurde beispielsweise in der Solarindustrie und der chemischen Industrie versucht, etwas aufzubauen. Nun scheint das gerade Aufgebaute wieder wegzubrechen aufgrund der Energiekrise und zum Teil durch die Nachwehen der Coronasituation, die einen Riss durch die Gesellschaft produziert hat. Die Generation, die jetzt von den Transformationen im Osten betroffen ist, hat bereits tief sitzende, zum Teil traumatische Erfahrungswerte aus der Nachwendezeit, und nicht wenige haben die berechtigte Angst, sie könnten wieder die Verlierer sein.
Nie wieder dürfen wir im Osten passiv über uns ergehen lassen, was andere für uns beschließen.”
Gesellschaft gestalten
Dabei steht Ostdeutschland für besondere Erfahrungen und Fähigkeiten. Es ist die Erfahrung von bestandenen Konflikten und Auseinandersetzungen: mit den „Mächtigen“ in der DDR und deren Erbe, mit der eigenen Geschichte, den eigenen Irrtümern, Fehlern und Versäumnissen. Die Erfahrung des Umgangs mit Veränderungen und Transformationen nach der Wende sowie eines Sich-immer-wieder-durchsetzen-Müssens. Das können wir, da sind wir stark.
Es stehen riesige Aufgaben an. Wir wollen aber keinen blinden Nachvollzug westdeutscher Erfahrungen, sondern eine Stärkung eigenständiger Zugänge. Vom „Osten lernen“ bedeutet zu akzeptieren, dass es Dinge gab, die besser funktioniert haben als in der heutigen Welt des Profitmachens. Wir brauchen geringere soziale Abstände und eine gerechtere Vermögensverteilung. Wir müssen gesellschaftliches Eigentum als richtigen Ansatz für die soziale Daseinsvorsorge betrachten. In Anbetracht der oftmals prekären Situation der Seniorinnen und Senioren brauchen wir einen Rententopf, in den alle einzahlen. Für mehr Klimaschutz brauchen wir Schienenverkehr statt Straße, Abfallvermeidung, Standards zur Erleichterung der Produktion und zur Ermöglichung von Reparaturen, Ressourcenkontingente statt Dividende für Mehrverbrauch. Ich kämpfe für eine aktive Industriepolitik, die sich für nachhaltige und gemeinwohlorientierte Ansiedlungen einsetzt. Um Perspektive vor Ort zu schaffen ist es wichtig, Firmen auch weiterhin aktiv für Industriestandorte anzuwerben. Dabei sollen diejenigen Unternehmen Unterstützung erhalten, die nachhaltig produzieren, sich an Tariflöhne halten und den Menschen vor Ort eine Perspektive geben. Im Gesundheitswesen brauchen wir Polikliniken, keine privaten Krankenkassen und keine Verwertungslogik im Gesundheitswesen.
Eine vitale Gesellschaft braucht ebenso ein reiches Kulturangebot sowie Jugend- und Sozialleben auch in den ländlichen Regionen und ein Bildungssystem, das niemanden zurücklässt.
Für all diese Veränderungen braucht es Offenheit und die Bereitschaft, unsere Erfahrungen zu nutzen. Gerade im Osten gibt es die Erfahrung, dass wir gesamtgesellschaftlich besser gestalten können. Als Kollektive, von deren Errungenschaften alle profitieren und nicht nur eine kleine Elite. Ich habe eine Offenheit im Umgang miteinander erlebt, die sozialen Zusammenhalt stark macht und Kämpfe verbindet. Zum Beispiel bei Streikbewegungen und Protesten. Ganze Familien gehen gemeinsam auf die Straße, um sich für bessere Bedingungen einzusetzen. Es gibt immer noch eine gemeinsame Sprache und, ganz wichtig bei allem, einen bestimmten Humor. All das sind wichtige Grundpfeiler einer funktionierenden Demokratie. Wir haben bereits erlebt, was es bedeutet, wenn das politisch abgewertet wird. Als Erstes wurden Kultur- und Freizeitprojekte gestrichen, an Sozial- und Bildungsprojekten wurde die Axt angelegt. Wer die materiellen Voraussetzungen nicht hat, wird zum Teil über Generationen abgehängt und Menschen werden isoliert.
In den Dialog treten zwischen den Generationen Ost heißt deshalb vor allem auch Erfahrungstransfers, Selbstermächtigung und Mitbestimmung auf allen Ebenen. Von den Kommunen bis in die höchsten Beamtenpositionen der ostdeutschen Länder und des Bundes müssen und wollen wir teilhaben und mitgestalten.
Die Ursachen für viele Veränderungen, die wir jetzt spüren, liegen zehn, fünfzehn Jahre und länger zurück. Das heißt auch, dass was wir vielleicht jetzt schon nicht mehr ändern können, was in zehn oder fünfzehn Jahren passiert. Aber vielleicht das, was danach kommt. Nie wieder dürfen wir im Osten wie auch generell passiv über uns ergehen lassen, was andere für uns beschließen. Wo Weichen gestellt werden, fordern wir Beteiligung. Wo Zukunftspläne beschlossen werden, fordern wir Mitsprache und Mitentscheiden. Doch niemand wird uns einladen. Wir müssen es einfordern und uns selbst helfen. Dafür haben wir eine verdammte Verantwortung.
Sören Pellmann
GEBOREN: 1977/Leipzig
WOHNORT (aktuell): Leipzig
MEIN BUCHTIPP: Jana Hensel: „Zonenkinder“, 2012
MEIN FILMTIPP: „Sonnenallee“, 1999
MEIN URLAUBSTIPP: Thüringer Wald
 BUCHTIPP: BUCHTIPP:
„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Dieser Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2024, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |