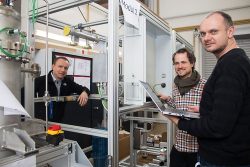Dr. Patrick Wittenberg, Vorstandsvorsitzender der E.DIS AG, spricht im Interview mit Wirtschaft+Markt (W+M) über den Boom der erneuerbaren Energien, die Transformation der Stromnetze und die Bezahlbarkeit der Energiewende.

Dr. Patrick Wittenberg, Vorstandsvorsitzender der E.DIS AG seit Juni 2024. Abbildung: E.DIS
W+M: Herr Dr. Wittenberg, die E.DIS AG hat 2024 ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Wie geht dem Unternehmen aktuell?
Dr. Patrick Wittenberg: E.DIS sorgt seit 25 Jahren für eine sichere Energieversorgung in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. In all den Jahren haben wir eine enorme Entwicklung vollzogen, vom Netzbetreiber, der fossile Energie in die Fläche bringt, zum Netz- und Infrastrukturdienstleister mit einem dominierenden grünen Stromanteil. Damit haben wir heute fast schon ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Dahinter steckt auch eine sehr intensive Aufgabe, denn wir befinden uns hier in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern im Herzen der Energiewende. Zu unseren wesentlichen Herausforderungen zählen der Stromnetzausbau sowie ein massiver Anschluss von Erneuerbare-Energien-Anlagen – und in der Folge die Weiterentwicklung unserer betrieblichen Strukturen, um all dies auch möglich machen zu können. Diese Entwicklungen finden innerhalb Deutschlands in unterschiedlicher Geschwindigkeit statt. Nicht überall waren und sind vergleichbare Herausforderungen zu meistern wie hier in unserem Stromnetzgebiet.
W+M: Was sind konkret die Herausforderungen für die E.DIS AG?
Dr. Patrick Wittenberg: Nur ein Beispiel: Wir haben allein im Jahr 2023 über 30.000 Photovoltaik-Anlagen an unser Stromnetz angeschlossen. Dabei reden wir von den kleineren Anlagen mit einer Leistung von unter 30 kW, wie sie sich beispielsweise auf Ein- und Mehrfamilienhäuser befinden. Drei Jahre zuvor lagen die Anschlusszahlen noch zwischen 5.000 und 5.500 Anlagen. Das heißt, wir haben bei E.DIS innerhalb von nur drei Jahren gleich eine Versechsfachung der Anschlusszahlen zu bewältigen gehabt. Dafür möchte ich unseren Beschäftigten, die dies ermöglicht haben, größten Respekt zollen. Außerdem haben wir in unserem Stromnetz zwischenzeitlich eine rund 150-prozentige Grünstromquote erreicht. Wir produzieren damit also das Eineinhalbfache des hier tatsächlich benötigten Verbrauchs.
Wir haben in unserem Stromnetz zwischenzeitlich eine rund 150-prozentige Grünstromquote erreicht.“
W+M: Wie haben Sie diesen Aufwuchs bei den erneuerbaren Energien bewältigt?
Dr. Patrick Wittenberg: Die Herausforderung lag im sprunghaften Anstieg der Anschlusszahlen. Unsere Prozesse waren bis dahin jedoch eher auf ein konstantes Wachstum ausgerichtet. Deshalb haben wir kurzfristig gegensteuern müssen. Wir haben neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt und gleichzeitig die Digitalisierung und Automatisierung unserer Netze weiter deutlich vorangetrieben.
W+M: Kann E.DIS mit dieser Entwicklung dauerhaft Schritt halten?
Dr. Patrick Wittenberg: Wir müssen den weiteren Ausbau unserer Stromnetze mit dem des Ausbaus und Anschlusses der erneuerbaren Energien in Übereinstimmung bringen. Es bringt nichts, immer mehr Leistung, das heißt weitere Erzeugungsanlagen zu errichten und an Trassen in unserem Stromnetz anzuschließen, wo wir bereits und noch auf Jahre Netzengpässe haben. Unsere Forderung an die Politik lautet deshalb auch ganz klar, diese beiden Geschwindigkeiten miteinander zu harmonisieren. Um die Diskrepanzen in Zahlen zu verdeutlichen: Planung und Bau eines größeren Photovoltaikparks dauern ein bis zwei Jahre. Wir benötigen als Netzbetreiber für die Planung, Genehmigung und den Bau einer 110-kV-Leitung jedoch acht bis zwölf Jahre.
W+M: Welche Lösungen bieten sich an?
Dr. Patrick Wittenberg: Einer unserer Vorschläge ist ein sogenannter Redispatch-Vorbehalt. Darunter ist Folgendes zu verstehen: Betreiber von Erzeugungsanlagen, die sich bewusst in Gebieten ansiedeln, in denen bereits Netzengpässe bestehen, erhalten für den Fall, dass sie aus Kapazitätsgründen abgeregelt werden müssen, auch keinen finanziellen Ausgleich mehr. Man kann es sich, vereinfacht gesagt, so vorstellen: Wenn es auf der Autobahn einen Stau gibt, ist es sinnvoll, eine Umleitung einzurichten, damit sich nicht weitere Autos im Stau anstellen und dieser immer länger wird. Derzeit ist es aber nicht nur so, dass keine Umleitung eingerichtet wird. Autos, die sich am Ende des Staus anstellen, werden sogar dafür entschädigt, das Ziel nicht erreichen zu können. Mit unserem Vorschlag, dem Redispatch-Vorbehalt, würde ein solcher finanzieller Ausgleich für Einspeiser, die sich bewusst in eine bestehende Engpassregion begeben, wegfallen. Die Idee ist nicht neu. Wir merken aber, dass im letzten Jahr das Thema Bezahlbarkeit der Energiewende viel stärker in den Fokus der Politik gerückt ist. Und der Redispatch-Vorbehalt wäre eine Möglichkeit zur Kostensenkung.
Der Redispatch-Vorbehalt wäre eine Möglichkeit zur Kostensenkung.“
W+M: Welche weiteren Vorschläge haben Sie?
Dr. Patrick Wittenberg: Wir mussten in Deutschland 2023 drei Milliarden Euro für das Engpassmanagement aufbringen. Im Jahr zuvor lagen die Kosten für die Abregelung wegen der Energiekrise sogar bei vier Milliarden Euro. Das sind Kosten, die entstehen, weil der Netzausbau nicht schnell genug vorankommt. Auch hier haben wir konkrete Vorschläge insbesondere hinsichtlich eines beschleunigten Ausbaus auf Bestandstrassen unterbreitet. Wenn wir auf Bestandstrassen neue Leiterseile aufziehen oder Strommasten verstärken, bedarf es heute umfangreicher Genehmigungsverfahren. Wenn wir diese verkürzen, würde das enorm viel Geld und Zeit sparen.
W+M: Wie könnte eine solche Verkürzung der Genehmigungsverfahren aussehen?
Dr. Patrick Wittenberg: Durch den Wechsel des Standardgenehmigungsverfahrens für den Leitungsausbau in der Hochspannung vor einigen Jahren wurden viele laufende Vorhaben zunächst wieder ein Stück weit auf null gesetzt. Der wesentliche Zeitbedarf in der Antragserstellung durch uns und in der Antragsbearbeitung durch die Behörden besteht im arten- und umweltschutztechnischen Prüfaufwand gemäß EU-Recht. Dieser sollte zumindest für den sogenannten Ersatzneubau, das heißt den Leitungsausbau in bestehender Trasse als geringstmöglicher Eingriff in Flora und Fauna, deutlich vereinfacht werden. Wir brauchen aber vor allem auch von allen Stakeholdern den Willen, es gemeinsam hinzubekommen, sodass es gelingt, die Verteilnetze so auszubauen, dass die strukturelle Entwicklung in der Region unterstützt und die Energiewende ein nachhaltiger Erfolg wird.
W+M: Was bedeutet die Transformation der Netze für die E.DIS AG?
Dr. Patrick Wittenberg: Es werden de facto immer weniger große Kraftwerke ans Netz angeschlossen. Stattdessen werden wir zu einer dezentralen Erzeugung übergehen. Dazu bedarf es eines kompletten Umbaus der Infrastruktur. So müssen wir neben dem geschilderten umfangreichen Ausbau unserer Stromnetze in all unseren Spannungsebenen beispielsweise auch unser Netz mit zusätzlicher digitaler Mess- und Steuertechnik ausstatten, um es zukünftig noch effizienter managen zu können.

„Wir befinden uns hier in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern im Herzen der Energiewende“, sagt Dr. Patrick Wittenberg. Abbildung: W+M
W+M: Inwiefern können Speicherlösungen bei dieser Transformation helfen?
Dr. Patrick Wittenberg: Die technologischen Lösungen wie Batteriespeicher sind ja bereits vorhanden. Die Entwicklung kostengünstigerer Hochenergiespeicher wird ebenfalls vorangetrieben. Die Netzbetreiber sind aber nach den heute geltenden Regelungen keine Speicherbetreiber. Wir haben eine zweistellige Zahl von Speicherbetreibern, die an unser Stromnetz angeschlossen werden wollen. Diese optimieren ihr Geschäftsmodell jedoch verständlicherweise nicht im Sinne der Netzdienlichkeit, das heißt zur Stabilisierung unseres Stromnetzes, sondern rein unter Marktgesichtspunkten. Insofern kann der Speicherbetrieb in diesem System den Netzausbau auch nicht ersetzen.
W+M: Welche Hoffnungen verbinden Sie mit dem Energieträger Wasserstoff?
Dr. Patrick Wittenberg: Wenn wir perspektivisch von den fossilen Energieträgern wegwollen, kommen wir am Wasserstoff nicht vorbei. Wir werden ihn vor allem für den Betrieb der Back-up-Kraftwerke benötigen. Diese kommen zum Einsatz, wenn der Strombedarf sehr hoch und die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu niedrig ist. Ebenso wird Wasserstoff in der energieintensiven Industrie benötigt. Für die breite Wärmeversorgung wäre der Einsatz von Wasserstoff aus meiner Sicht zu aufwändig. Die Produktion von grünem Wasserstoff aus hiesigen erneuerbaren Energien kann zudem einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten. Neben der Eigenerzeugung wird ein großer Teil des Wasserstoffs importiert werden müssen.
W+M: Inwieweit verzögert der Fachkräftemangel den Netzausbau?
Dr. Patrick Wittenberg: Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir auch in diesem Jahr alle Ausbildungsplätze bei E.DIS besetzen konnten. Insgesamt haben wir rund 200 Auszubildende im Unternehmen, das ist ein toller Wert. Auch haben wir unsere neuen offenen Stellen im Unternehmen im letzten Jahr alle besetzen können. Perspektivisch wird das sicherlich schwieriger. Wir sehen durchaus, dass der Fachkräftemangel schon heute ein Problem für unsere Partnerunternehmen und Dienstleister darstellt. Und für den zukünftigen Netzausbau werden wir künftig noch mehr Material und mehr Dienstleistungen benötigen.

„Wir brauchen Anpassungen bei der Energiewende“, so Dr. Patrick Wittenberg gegenüber Frank Nehring und Matthias Salm vom Redaktionsnetzwerk Wirtschaft+Markt. Abbildung: E.DIS
W+M: Es gibt immer wieder Stimmen, die die Energiewende für gescheitert erklären. Wie stehen Sie zu dieser These?
Dr. Patrick Wittenberg: Ich halte diese Aussage so für nicht richtig. Mit Blick auf die Energiewende haben wir in Deutschland zwischenzeitlich vieles erreicht, was wir vor einigen Jahren so nicht für möglich gehalten hätten. Beispielsweise stammen heute bereits über 50 Prozent des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien. Allein bei E.DIS schließen wir, wie eingangs erläutert, zwischenzeitlich Jahr für Jahr mehrere zehntausend kleinere Erzeugungsanlagen ans Netz an – neben den vielen großen Solarparks und Windkraftanlagen. Szenarien, nach denen die Netze dies nicht verkraften werden, haben sich nicht bewahrheitet. Es ist aber auch richtig, dass wir noch Anpassungen und vor allem Effizienzsteigerungen rund um die Energiewende brauchen. Die Kosten beschäftigen viele Menschen und Unternehmen – und das nicht ohne Grund. Der Strom muss bezahlbar bleiben. Deshalb müssen wir in einigen Punkten gegensteuern und uns über die gerechte Verteilung der Kosten Gedanken machen. Wie erwähnt sind wir da unter anderem mit dem Redispatch-Vorbehalt dran.
W+M: Sind die neuen Regelungen zum Netzentgelt ein erster Schritt in die richtige Richtung?
Dr. Patrick Wittenberg: Seit dem 1. Januar 2025 werden die Kosten für die Netzentgelte gerechter verteilt, die rund ein Drittel des Strompreises ausmachen. Im Netzgebiet der E.DIS bedeutet dies eine Senkung der Netzentgelte für Endkunden um rund 20 Prozent – für Gewerbe und Industrie teilweise sogar noch mehr. Kunden in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein werden dadurch entlastet, denn hier wird besonders viel Energie aus erneuerbaren Energien gewonnen. Als großer ostdeutscher Netzbetreiber mit einer überdurchschnittlich hohen Grünstromquote haben wir dafür in den letzten Jahren ausdrücklich gegenüber Politik und Behörden geworben.
W+M: Es sind enorme Investitionen in das Stromverteilnetz nötig. Wie bekommen wir das finanziert?
Dr. Patrick Wittenberg: Der Ausbau der Netze und damit auch ihre Finanzierung sind der Schlüssel für ein erfolgreiches Gelingen der Energiewende. Statt auf den Staat zu setzen, müssen wir privates Kapital durch attraktive Investitionsrenditen anziehen. Dabei befinden sich die deutschen Stromnetzbetreiber auch mit anderen Branchen im In- und Ausland in einem internationalen Wettbewerb um Kapital. Das bedingt, dass die regulierten Renditen auch die Anstrengungen der deutschen Netzbetreiber widerspiegeln – im Vergleich zu anderen Regulierungssystemen haben wir hier noch Nachholbedarf. Diesen Zusammenhängen muss auch die Regulierung in Deutschland, deren Erfolg sich nicht nur an einer möglichst preisgünstigen Energienetzinfrastruktur, sondern auch an einem Gelingen einer versorgungssicheren und bedarfsgerechten Energiewende bemisst, Rechnung tragen. Das regulatorische Umfeld muss sich so entwickeln, dass es sich für die Kapitalgeber der Netzbetreiber auch lohnt, stärker zu investieren. Hierfür sind zwingend die richtigen Weichenstellungen bei der aktuellen Ausgestaltung der künftigen Anreizregulierung für die Verteilnetze erforderlich. In diesem Zusammenhang ist insbesondere ein adäquater Refinanzierungsrahmen für alle Investitionen – auch der Bestandsinvestitionen – sicherzustellen.
W+M: Vielen Dank für das Gespräch.
Die Fragen stellten Frank Nehring und Matthias Salm vom Redaktionsnetzwerk Wirtschaft+Markt.

|
Zum Unternehmen: Die E.DIS AG, einer der größten regionalen Energiedienstleister Deutschlands, betreibt mit ihrer Tochter, der E.DIS Netz GmbH, in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf einer Fläche von 35.500 Quadratkilometern ein 82.500 Kilometer langes Stromleitungsnetz sowie im Osten Mecklenburg-Vorpommerns und Norden Brandenburgs ein rund 5.100 Kilometer langes Gasleitungsnetz. |