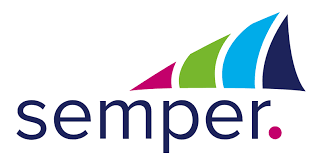Die Gesellschaft lebt in einer Zeit der Entfremdung zwischen den politischen Lagern sowie zwischen Stadt und Land. In seinem Buch wirft Simon Strauß einen Blick auf die Sehnsucht der Ostdeutschen nach Nähe und sucht in einer ostdeutschen Kleinstadt nach Antworten.
| BUCHTIPP:
|
Zur Einführung greift der Autor auf das Theaterstück „Unsere kleine Stadt“ des amerikanischen Schriftstellers Thornton Wilder aus dem Jahr 1938 zurück. Strauß, der in Berlin und der Uckermark aufgewachsen ist, kam während seiner Schulzeit durch eine Theater-AG erstmals mit dem Stück in Berührung. Für ihn steht die Kleinstadt für einen Ort, an dem Menschen einander als Gegenüber begegnen, Konflikte austragen und Kompromisse finden. Hier lasse sich Demokratie unmittelbar erfahren. Mit dem Bild eines langen Tisches, an dem unterschiedliche Menschen Platz finden, begibt sich Strauß auf die Suche nach seiner Kleinstadt. Nach rund zwanzig Jahren hat er mit dem eineinhalb Autostunden von Berlin in Richtung Polen entfernt liegenden Prenzlau seine Stadt gefunden.
Strauß besucht Prenzlau über einen Zeitraum von zwei Jahren immer wieder und sucht das Gespräch mit unterschiedlichen Stadtbürgern. Im Zentrum seiner Recherchen steht die Frage, welche Kraft der gemeinsame Glaube an einen konkreten Ort entfalten kann und ob es so etwas wie einen geteilten Himmel noch gibt – oder inzwischen jeder allein nach den Sternen greift.
In seinen Gesprächen begegnet der Autor Menschen, die er in Anlehnung an die Definition des Althistorikers Christian Meier als „könnensbewusst“ beschreibt. Dieses Können-Bewusstsein steht laut Meier für einen Fortschrittsgedanken und die Vorstellung positiver Veränderung, wie sie bereits die alten Griechen prägten. Laut Strauß leben in Prenzlau viele solcher Menschen, die bleiben, Verantwortung übernehmen und so aus einer Stadt eine Gemeinschaft machen.
Ein Beispiel hierfür ist der Prenzlauer Geschichtslehrer und Politiker der Partei Die Linke, Jörg Dittberner. Er erinnert an Werte, die seiner Wahrnehmung nach in der DDR-Zeit galten, insbesondere an den sozialen Zusammenhalt. Er beschreibt eine Gesellschaft, in der die Menschen Dinge gemeinsam getan haben und nicht nebeneinanderher lebten, sowie Orte, die dieses Miteinander ermöglichten. Dazu zählen Hausgemeinschaften, in denen sich alle Bewohner kannten und vertrauten und denen man während des Urlaubs den Hausschlüssel anvertrauen konnte. Ein anderes Beispiel sind die Ost-Garagen, die auch als Treffpunkte der Geselligkeit dienten. Dieser „Ost-Wert“ taucht in vielen Gesprächen des Autors immer wieder auf und wirkt als verbindendes Element.
Gleichzeitig macht Strauß deutlich, dass Sehnsucht nach Nähe auch aus Angst vor dem Fremden entstehen kann. Er schildert eine Diskussion in Prenzlau über die Errichtung eines zweiten Flüchtlingsheims, gegen die eine Petition mit 15.700 Unterschriften eingereicht wurde. In diesem Zusammenhang erwähnt er den AfD-Politiker und Landtagsabgeordneten Felix Teichner, den er später persönlich treffen wird. Teichner, 1991 in Prenzlau geboren, verbindet Ost-Identität mit dem Gefühl von Freiheit, beispielsweise beim Mopedfahren ohne staatliche Kontrolle. Wie Dittberner betont auch er den Wert von Zusammenhalt und gesellschaftlichem Miteinander, die er als verloren empfindet. Gleichzeitig äußert er eine grundlegende Systemkritik und den Wunsch nach einer wieder überschaubaren Welt. Teichner berichtet von seinem zeitweiligen Aufenthalt in Hannover und beschreibt die dort empfundene Anonymität im Vergleich zur Vertrautheit und Gemeinschaft Prenzlaus.
Neben ihm stellt Strauß auch den Flüchtling Hamza Albeidiwi vor. Er wurde in Syrien geboren und floh aufgrund des Krieges über die Balkanroute nach Deutschland. 2021 kam er in das Flüchtlingsheim in Prenzlau. Er sieht die Möglichkeiten, die sich ihm in Deutschland bieten, als Chance, durch ehrenamtliche Arbeit Nähe aufzubauen. Wie Teichner und Dittberner sehnt auch er sich nach Verbundenheit – nach einer Nähe, die ihm durch den Krieg genommen wurde. Strauß beschreibt Albeidiwis Kampf darum, geduldet zu werden und sich als zukünftiger Bürger Prenzlaus fühlen zu können.
In einem weiteren Teil seines Buches spricht der Autor mit einer Kitaleiterin, die den gesellschaftlichen Wandel in Prenzlau beschreibt. Während in ihrer Einrichtung früher eine relative Homogenität mit wenigen unterschiedlichen Sprachen herrschte, werden heute 104 Kinder aus 18 Nationen betreut. Diese Vielfalt führt zu kulturellen Konflikten und erschwert die Eingewöhnung sowie den Aufbau von Nähe.
Strauß führt auch ein Gespräch mit den ehemaligen Arbeitern Ferdinand Strotkötter, Peter-Jörg Mahnke und Norbert Zart, die im Armaturenwerk Prenzlau (AWP) beschäftigt waren. Sie erzählen die Geschichte des Betriebs vor und nach der Wende, die zugleich ihre eigene ist. Sie berichten von der starken Verbundenheit innerhalb des Werks und davon, wie die das AWP nach der Wende wie ein geschlachtetes Tier in Einzelteile zerlegt und verschiedenen Käufern angeboten wurde.
Strotkötter, Mahnke und Zart kämpften darum, die Zukunft der Kältetechnik des Armaturenwerks zu sichern. Eindrücklich schildern sie den Versuch, innerhalb von vier Wochen über eine Bürgschaft der Sparkasse Uckermark kreditwürdig zu werden, sowie den anschließenden Druck der Treuhand, die ihnen einen Vertrag ohne Alternative nach dem Prinzip „Friss oder stirb“ vorlegte.
Auch Hendrik Sommer, der parteilose Bürgermeister von Prenzlau, kommt zu Wort. Er beschreibt eine ausgeprägte Unzufriedenheit in der Bevölkerung der Stadt. Diese entstehe weniger aus lokalen Missständen als aus der als fern und weltfremd empfundenen Politik der Berliner Regierung. Die moralisch abgehobene Haltung aus der Hauptstadt führe dazu, dass sich manche Bürger Agitatoren zuwenden.
Der Autor spricht mit Sophie Ludwig, der Pfarrerin der evangelischen St.-Marien-Kirche, über den Bedeutungsverlust der Volkskirche. Sie erzählt, dass die DDR-Vergangenheit Spuren hinterlassen habe, sodass der sonntägliche Gottesdienst für viele Prenzlauer keine zentrale Rolle mehr spiele. Dennoch würden zahlreiche Bürger eine tiefe Verbundenheit mit dem weithin sichtbaren Gotteshaus empfinden, das ein Wahrzeichen der Stadt ist.
In einem weiteren Kapitel nimmt Strauß die Leserschaft mit in Erzählungen über die letzten Kriegstage in Prenzlau. Er zeigt auf, wie in den Darstellungen der DDR-Zeit die Schuld der Roten Armee an der Zerstörung der Stadt ausgeblendet wurde, was eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte erschwerte. Der Autor berichtet von dem Schiffsbautechniker und Hobbyhistoriker Wilhelm Zimmermann, der bei einer Veranstaltung des Uckermärkischen Geschichtsvereins über die Zerstörungen durch die Rote Armee sprach. In diesem Zusammenhang thematisiert Strauß auch den Versuch der DDR-Führung, die Wunden der Vergangenheit mit hastig errichteten Plattenbauten sowie einem funktionalen Stadtzentrum mit Springbrunnen und Touristeninformation zu kaschieren.
An anderer Stelle seines Buches schildert der Autor ein Gespräch mit Matthias Platzeck, dem ehemaligen Ministerpräsidenten Brandenburgs, der in der Nähe von Prenzlau lebt und eng mit der Region verbunden ist. Platzeck beschreibt die Situation in Ostdeutschland nach der Wende. Rund drei Viertel der Ostdeutschen hätten zwischen 1989 und 1994 ihren Arbeitsplatz gewechselt. Der gleichzeitige Verlust von Arbeit, sozialen Strukturen und gewachsenen Gemeinschaften habe bei vielen ein Gefühl des Überdrusses ausgelöst. Arbeitsplätze, die Nähe und Miteinander ermöglichten, seien verschwunden, während soziale Kompetenzen plötzlich wertlos geworden seien. Dadurch sei ein Loch entstanden, aus dem manche Menschen nicht mehr herausgefunden hätten. Platzeck wünscht sich einen selbstbewussten „Oststolz”, der als Ausdruck von Nähe und Identität nach außen getragen wird.
In seinem Fazit formuliert Strauß einen Appell für Nähe als politische Grundkategorie. Politik sollte sich nicht an der Anzahl von Gesetzesvorlagen messen lassen, sondern am Grad des gesellschaftlichen Miteinanders. Demokratie könne gestärkt werden, wenn sie das Bedürfnis nach Nähe ernst nehme und es politisch umsetze.
Dem Autor ist ein persönliches und vielstimmiges Porträt der gesellschaftlichen Sehnsüchte in einer ostdeutschen Kleinstadt gelungen. In den sehr unterschiedlichen Lebensgeschichten der von ihm interviewten Personen zeigt sich ein gemeinsamer Kern: die Sehnsucht nach Nähe, Verbundenheit und Gemeinschaft.



 Simon Strauß: „In der Nähe. Vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht“, Tropen Verlag, Stuttgart 2025, 240 Seiten, 24 € (Hardcover).
Simon Strauß: „In der Nähe. Vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht“, Tropen Verlag, Stuttgart 2025, 240 Seiten, 24 € (Hardcover).