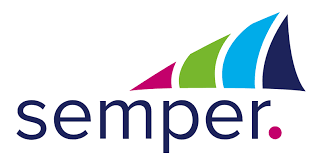Dr. Gregor Gysi, Bundestagsabgeordneter für Die Linke und Rechtsanwalt, ist ein wichtiger Impulsgeber für Ostdeutschland. Er setzt sich ein für Vergewisserung, Verständigung und Versöhnung. Mit diesem Beitrag ist er auch in dem Sammelband „Denke ich an Ostdeutschland ...“ vertreten.
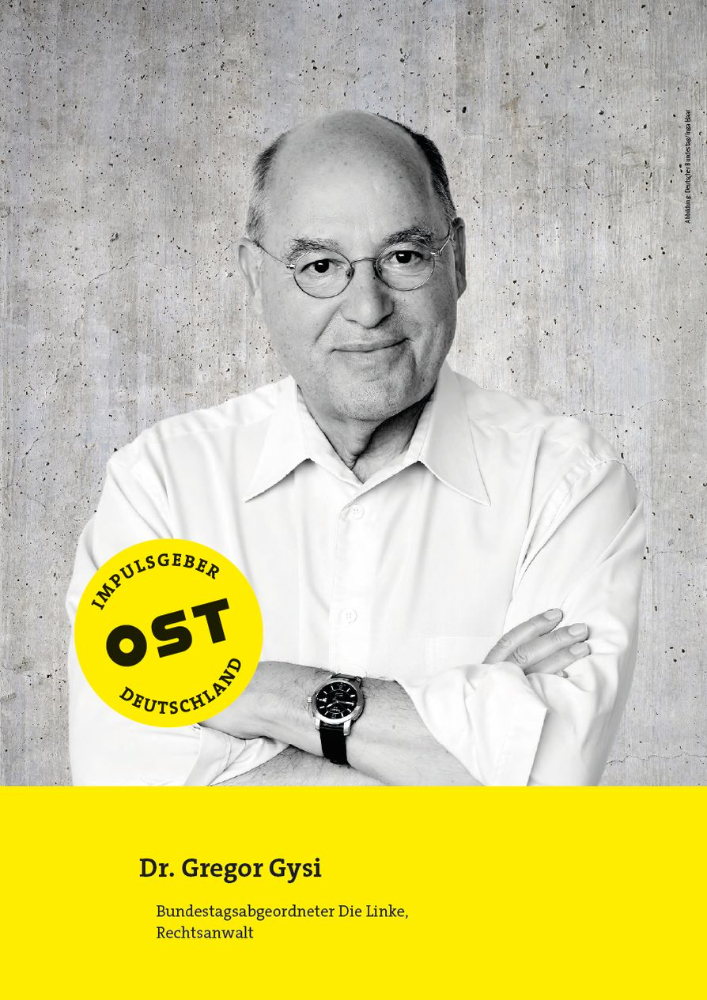
Dr. Gregor Gysi, Bundestagsabgeordneter Die Linke, Rechtsanwalt. Abbildung: Deutscher Bundestag/Inga Haar
Es brauchte nicht erst die von der „Zeit“ im vergangenen Jahr kolportierten Sottisen von Springer-Chef Döpfner aus dem Jahre 2019, um zu erkennen, dass ein Teil der westdeutschen Eliten noch immer nicht in der Einheit angekommen ist. Der Osten bleibt für sie ein Beitrittsgebiet, das sich gefälligst nach den Regeln der alten Bundesrepublik zu verhalten hat. Daraus spricht eine Geringschätzung, ja Verachtung, die den Ostdeutschen de facto die Eigenständigkeit in unserem demokratischen Gemeinwesen abspricht. Döpfner wünschte sich, „aus der ehemaligen ddr eine Agrar und Produktions Zone mit Einheitslohn (zu) machen“. Man stelle sich mal vor, jemand hätte Ähnliches für den Westen vorgeschlagen?! Bemerkenswert war auch das Datum, das Döpfner für seine Äußerungen wählte – den Oktober 2019, als sich zum 30. Mal der Aufbruch der DDR-Bevölkerung jährte. Das war eine beispiellose Infamie. Die Döpfners tragen für die heutige Haltung der Ostdeutschen zum Gesamtstaat, die sich verbreitende Ablehnung der bundesdeutschen Strukturen, eine große Verantwortung.
Die Demonstrierenden in Plauen, Leipzig, Berlin und vielen anderen Städten haben erfolgreich für Freiheit und Demokratie in der DDR gekämpft. Nicht Helmut Kohl und seine Bundesregierung und schon gar nicht der Springer-Konzern brachten die Freiheit in den Osten, sondern diese Demonstrantinnen und Demonstranten im Osten selbst. Der 9. Oktober 1989 mit der großen Demonstration in Leipzig gilt heute als entscheidendes Symbol des Aufbegehrens. Friedrich Schorlemmer sagte, dass sich in seinen Augen an diesem 9. Oktober auch Weltgeschichte entschied. Ich denke, er hat Recht. Die Menschen, die 1989 den Mut besaßen und auf dem Leipziger Ring zur größten unangemeldeten Demonstration in der DDR zusammenkamen, haben Geschichte geschrieben. Und sie haben mehr für die Demokratie und die Freiheit getan, als es Mathias Döpfner und seinesgleichen je taten. Hinzu kommt die größte Kundgebung in der deutschen Geschichte am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz in Berlin. Freiheit ist übrigens erst dann vollendet, wenn sie zur Befreiung führt. Viele Menschen im Osten fühlen sich aber nicht befreit.

Meilenstein der friedlichen Revolution: 500.000 Bürger demonstrierten am 4. November 1989 in Ostberlin. Gregor Gysi gehörte zu den Rednern auf der Abschlusskundgebung. Abbildung: Wikimedia Commons/Hubert Link, Bundesarchiv Bild 183-1989-1104-042
Urdemokratischer Impuls
Die Bereitschaft der Menschen in der DDR vor 30 Jahren, bis dahin Unerhörtes einfach zu tun, mit Massendemonstrationen, neuen Parteien und Organisationen die Machtstruktur der SED infrage zu stellen, ohne sie gewaltsam beseitigen zu wollen, folgte einem urdemokratischen Impuls. Er täte auch den heutigen Verhältnissen durchaus gut. Die Runden Tische zum Beispiel waren ein demokratisches Instrument, dessen wir uns wieder aktiv erinnern sollten bei der Lösung aktueller Probleme. Die Friedlichkeit hatte zwei Seiten: „Keine Gewalt“ durch Demonstrierende und der Verzicht darauf bei den Soldaten, bei der Polizei – nicht gleich, aber ab dem 9. Oktober 1989. Es ist eine beachtliche Leistung, dass während des Umbruchs kein einziger Schuss fiel von den sogenannten bewaffneten Organen der DDR (Polizei, Armee, Zoll, Staatssicherheit, Kampfgruppen). Beides ist zu würdigen, nicht schwarz-weiß, sondern das große Dazwischen bestimmt den Lauf der Geschichte.
Der Prozess des Machtwechsels geschah einzigartig, in äußerst strittigem Dialog und nicht mit rigorosen Konsequenzen für die alten Machthaber. Manchen erscheint das inkonsequent, aber aus meiner Sicht zeigt sich gerade darin eine demokratische Kraft und Reife, die zugleich dafür sorgte, dass der Alltag für die Menschen weiterlief. Diese Größe hatte die Bundesrepublik im Umgang mit den alten Machthabern der DDR nicht.
Vielleicht sollte man sich mal anschauen, wie der 1. FC Union zu einem Klub geworden ist, der es aus der vierten Liga bis in die Champions League geschafft hat.”
Selbstvertrauen Ost, Lebensqualität West
Kohls Versprechen der blühenden Landschaften und die dahinterstehende Haltung, dass aus der Einheit kein neues gemeinsames Deutschland, sondern letztlich nur eine erweiterte Bundesrepublik entstünde, war eine den Einheitsprozess bis heute prägende Fehleinschätzung. Die Deutschen aus der DDR hatten nach dem 3. Oktober 1990 das Gefühl, zu Deutschen zweiter Klasse zu werden. Die Bundesregierung konnte damals nicht aufhören zu siegen. Die Regierenden strahlten nicht nur eine gewisse Arroganz aus, sondern waren vor allem nicht bereit, sich die DDR genau anzuschauen und sinnvoll positive Seiten aus ihr im vereinten Deutschland zu bewahren. Die DDR wurde ausschließlich mit Mauertoten, Staatssicherheit und SED identifiziert. Aber es gab auch ein Leben in ihr. Dieses interessierte aber nicht. Ich erinnere an den deutlich höheren Grad der Gleichstellung der Geschlechter im Vergleich zur alten Bundesrepublik. Man darf auch an die Berufsausbildung mit Abitur, die Polikliniken und die Art und Weise der Müllentsorgung erinnern. Die BRD war damals eine Wegwerf-, die DDR eine Behaltegesellschaft. Hätte die Bundesregierung solche Seiten übernommen, wäre das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen gestärkt und nicht nach unten gedrückt worden. Wir hätten uns gesagt: Wir hatten zwar eine Diktatur, aber sechs Gegebenheiten waren so gut, dass sie jetzt in ganz Deutschland gelten. Die Westdeutschen hätten erlebt, dass sich ihre Lebensqualität in diesen sechs Gebieten durch den Osten erhöhte. Das ist ihnen nicht gegönnt worden. All das hat Konsequenzen für das Denken und Fühlen in West und Ost bis heute.
Die Lohnlücke zwischen Ost und West besteht nach wie vor – 20 Prozent verdient man im Osten durchschnittlich weniger als im Westen. Das gilt auch für ungleiche Arbeitszeit, im Osten länger als im Westen. Für die gleiche Lebensleistung gibt es nach wie vor keine gleiche Rente. Erst seit dem vergangenen Jahr, 33 Jahre nach Herstellung der Einheit, sind die Rentenwerte nominell angeglichen. Aber die geringeren Löhne aus der Vorzeit und heute drücken auch die Einzahlungen in die Rentenkasse, sodass Ostdeutsche selbst in 33 Jahren noch niedrigere Renten haben werden als Westdeutsche bei vergleichbaren Erwerbsbiografien. Und die Ungleichbehandlung in vielen Berufsgruppen, zum Beispiel bei Polizistinnen und Polizisten, Ingenieurinnen und Ingenieuren bis zu mithelfenden Angehörigen privater Handwerkerinnen und Handwerker bleibt.
Bemerkenswert ist, dass es praktisch keine Änderung gibt seit über 30 Jahren. Der Lohnabstand zwischen West und Ost wird nicht kleiner. Das ist schlicht und einfach skandalös. Seit 1995, als in den westdeutschen Unternehmen die 35-Stunden-Woche erkämpft wurde, musste ein Metaller im Osten 4.000 Stunden länger arbeiten – das sind zwei Arbeitsjahre. Die Gewerkschaften taten zu wenig. Dass es so ist, liegt aber auch daran, dass sich die Bundesregierung nie energisch für eine wirkliche Einheit einsetzte und sich die Ostdeutschen zu wenig wehrten. Jeder kleine Schritt musste der Bundesregierung abgerungen werden. Angela Merkel, der Kanzlerin aus dem Osten, war der Osten leider auch nicht wichtig genug.
Es zeigt sich auch daran, dass nur zwei von 35 beamteten Staatssekretärinnen und Staatssekretären in den Bundesministerien der Ampel-Koalition und nur elf von 135 Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern aus dem Osten kommen. Insgesamt sind nur 13,9 Prozent der Führungspositionen in 94 Bundesbehörden, vier Verfassungsorganen und fünf Bundesgerichten mit Ostdeutschen besetzt. Nimmt man nur die ostdeutschen Flächenländer, sind es sogar nur 7,4 Prozent. Das ist schon deshalb grundgesetzwidrig, weil dort nicht nur gleiche Lebensverhältnisse, sondern auch eine angemessene Beteiligung sämtlicher Bundesländer auf der Leitungsebene des Staates gefordert werden.

15. Februar 1990: Gregor Gysi spricht als Vorsitzender der PDS vor über 6.000 DDR-Bürgern in Schwerin. Abbildung: Wikimedia Commons/Wolfried Paetzold, Bundesarchiv Bild 183-1990-0215-023
Gefühl der Benachteiligung
Dass bei Löhnen und Renten zwischen Ost und West endlich Augenhöhe hergestellt werden muss, ist auch eine Frage des Respekts und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Den Ostdeutschen und dem Osten wurde seit 1990 nie das Gefühl von Gleichwertigkeit vermittelt. Die reale und gefühlte Benachteiligung wurde auch auf die Generationen übertragen, für die die Wende ebenso wie der Mauerfall Ereignisse aus Geschichtsbüchern sind, die sie sich kaum vorstellen können. Dennoch erleben sie selbst und in ihren Familien, worauf sich das Gefühl, benachteiligte Menschen zu sein, gründet. Dies verschwindet erst dann, wenn es keine konkreten Benachteiligungserfahrungen mehr gibt, deutlich mehr für Arbeitsplätze und Jugend im Osten getan wird und das Potenzial, das im Osten aus dem Umgang mit einem Epochenumbruch erwachsen ist, endlich für die Bewältigung der aktuellen Krisen in Gesellschaft und Wirtschaft genutzt wird. Investitionen wie die von Tesla oder Intel machen deutlich, dass internationale Konzerne dieses Potenzial offenbar eher erkennen als die (west)deutsche Wirtschaft es vermag – und die Politik es auch unzureichend fördert. Die von Union und FDP Anfang der 2010er-Jahre maßgeblich dem Ausverkauf preisgegebene Solarindustrie war eben vor allem im Osten beheimatet. Wie könnten uns heute entsprechende Forschungs- und Produktionskapazitäten inklusive des damals noch bestehenden technologischen Vorsprungs helfen, die eigene Energiewende voranzutreiben und zugleich auf dem Weltmarkt präsent zu bleiben.
Dieses Potenzial des Ostens aktiv für das ganze Land zu nutzen, wäre auch eine Voraussetzung dafür, rechtsextremen Kräften das Wasser abzugraben, die aus den politischen Enttäuschungen und sozialen Abstiegsängsten im Osten Kapital zu schlagen suchen. Denn machen wir uns nichts vor. Die Enttäuschungen haben sich über 30 Jahre lang ins ostdeutsche Bewusstsein eingegraben und korrespondieren mit dem zur Wendezeit Erlebten. Dies wird sich nicht von heute auf morgen mit ein paar Milliarden für die Investitionsförderung verändern lassen, sondern nur mit einer langfristig angelegten Politik, die gesellschaftlichen Krisen, noch dazu, wenn sie existenzieller Natur sind, strikt in sozialer Verantwortung begegnet und zugleich das Bewusstsein fördert, dass sich globale Krisen gerade nicht durch nationale Abkapselung lösen lassen. Dies muss die Politik in Bund und Ländern ausstrahlen, statt die falschen Narrative der Demokratieverächter aufzunehmen und damit zu verstärken.
Vielleicht sollte man sich dafür mal anschauen, wie der 1. FC Union aus dem Osten Berlins zu einem Klub geworden ist, der es von 2006 bis 2023 aus der vierten Liga bis in die Champions League geschafft hat. Mit der Kraft seiner Fans, unterstützt von dem einen oder anderen Investor, durch harte Arbeit, kluge Personalpolitik, Vertrauen in die handelnden Personen, mit der Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen, und über das Finden versteckter Potenziale bei den Transfers aus dem In- und Ausland. Man kann es schaffen – wenn man will und an sich, aber auch an andere glaubt.
Dr. Gregor Gysi
GEBOREN: 1948/Berlin (Ost)
WOHNORT (aktuell): Berlin
MEIN BUCHTIPP: Katja Hoyer: „Diesseits der Mauer“, 2023
MEIN FILMTIPP: „Flüstern und Schreien“, 1988
MEIN URLAUBSTIPP: Hiddensee
 BUCHTIPP: BUCHTIPP:
„Denke ich an Ostdeutschland ...“In der Beziehung von Ost- und Westdeutschland ist auch 35 Jahre nach dem Mauerfall noch ein Knoten. Dieser Sammelband will einen Beitrag dazu leisten, ihn zu lösen. Die 60 Autorinnen und Autoren geben in ihren Beiträgen wichtige Impulse für eine gemeinsame Zukunft. Sie zeigen Chancen auf und skizzieren Perspektiven, scheuen sich aber auch nicht, Herausforderungen zu benennen. Die „Impulsgeberinnen und Impulsgeber für Ostdeutschland“ erzählen Geschichten und schildern Sachverhalte, die aufklären, Mut machen sowie ein positives, konstruktiv nach vorn schauendes Narrativ für Ostdeutschland bilden. „Denke ich an Ostdeutschland ... Impulse für eine gemeinsame Zukunft“, Frank und Robert Nehring (Hgg.), PRIMA VIER Nehring Verlag, Berlin 2024, 224 S., DIN A4. Als Hardcover und E-Book hier erhältlich. |