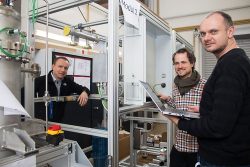Um die Akzeptanz der fortschreitenden Energiewende in der Gesellschaft zu sichern, müssen wir auch über die Bezahlbarkeit sprechen, findet Dr. Patrick Wittenberg, Vorstandsvorsitzender der E.DIS AG. Wir besuchten ihn Anfang Juli in Potsdam.

Dr. Patrick Wittenberg, Vorstandsvorsitzender der E.DIS AG. Abbildung: Uwe Tölle für E.DIS AG
ostdeutschland.info: Herr Dr. Wittenberg, die aktuelle Bundesregierung ist noch jung. Welchen Eindruck haben Sie von ihr vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen um Energiefragen?
Dr. Patrick Wittenberg: Einen positiven. Davon konnte ich mich schon auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow Mitte Mai überzeugen. Ich freue mich, dass die neue Bundesregierung ein Hauptaugenmerk auf die aktuellen Herausforderungen der Energiewende legt, vor denen auch wir als Verteilnetzbetreiber stehen. Genau daran knüpfen wir an, um unsere Vorschläge für eine deutlich effizientere Vorgehensweise einzubringen. Aus unserer Sicht ist es jetzt an der Zeit, einen „Neustart“ bei der Energiewende zu wagen.
Sind Sie mit den im Koalitionsvertrag genannten Vorhaben für den Energiesektor zufrieden?
Es muss jetzt darum gehen, Deutschland zu reformieren und wieder zu Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu führen. Bezogen auf die Energiepolitik heißt das: Die Energiewende muss so effizient wie möglich gestaltet werden, um die Kosten im Griff zu behalten. Der Koalitionsvertrag adressiert hier viele wichtige Punkte, die Herausforderung liegt aus unserer Sicht darin, dass wohl nicht alle Maßnahmen im Papier gleichzeitig finanzierbar sein werden. Deshalb müssen nun die richtigen Prioritäten gesetzt werden.
Wenn die Bundesregierung ihre ersten 100 Tage im Amt war, was sollte bis dahin im Bereich Energie klar kommuniziert bzw. umgesetzt sein?
Zunächst möchte ich betonen, dass auch wir als großer ostdeutscher Verteilnetzbetreiber der neuen Bundesregierung als verantwortlicher Dialogpartner zur Verfügung stehen. Wir begrüßen die explizite Stärkung der Stromnetze – insbesondere auch der Stromverteilnetze als Rückgrat der Energiewende. Im Koalitionsvertrag gibt es eine ganze Reihe von geeigneten Anknüpfungspunkten: Wir brauchen insbesondere mehr Planbarkeit und Verlässlichkeit, was den Ausbau der Erneuerbaren und der Energieinfrastruktur angeht. Der Weg zur Klimaneutralität muss insgesamt marktrationaler gestaltet werden; der Ausbau von Erneuerbaren und Speichern muss mit vorhandenen Netzkapazitäten und dem Netzausbau synchronisiert und netzdienlicher ausgerichtet werden. Auch dazu finden sich wichtige Punkte im Koalitionsvertrag, etwa die regionale Steuerung des Zubaus oder das grundsätzliche energiepolitische Ziel, dass Erneuerbare Verantwortung im System übernehmen müssen.

Christian Marx und Robert Nehring (v. r. n. l.) im Interview mit Dr. Patrick Wittenberg am Standort der E.DIS in Potsdam. Abbildung: ostdeutschland.info
Die E.ON-Tochter E.DIS entstand 1999 aus dem Zusammenschluss von vier nordostdeutschen Versorgungsunternehmen. Wie hat sich das Unternehmen seitdem gewandelt?
Nach 26 aufregenden Jahren in der ostdeutschen Energiewirtschaft hat sich E.DIS in vielerlei Hinsicht spürbar verändert. Die Fusion zur E.DIS war zunächst auch eine Antwort auf die Liberalisierung des Strommarktes. Stand in den ersten Jahren auch noch der Verkauf von Stromprodukten an Industrie-, Gewerbe- und Endkunden im Vordergrund, wandelte sich das Unternehmen aufgrund veränderter Rahmenbedingungen in den folgenden Jahren zu einem reinen Infrastruktur-Betreiber von Strom- und Gasnetzen. Mit ihren spezialisierten Tochterunternehmen bietet die E.DIS-Gruppe heute als einer der größten Netzbetreiber Deutschlands auch ein vielfältiges Portfolio an Dienstleistungen rund um die Energieversorgung. Hinzu kommt der Ausbau des Glasfasernetzes in unserer Region. Innerhalb der Unternehmensgruppe arbeiten derzeit rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 40 Standorten in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Sie kümmern sich ganz maßgeblich um das Gelingen der Energiewende in Ostdeutschland.
Der Weg zur Klimaneutralität muss insgesamt marktrationaler gestaltet und Ausbau und Einspeisung von Erneuerbaren und Speichern müssen netzdienlicher ausgerichtet werden.“
Seit 2000 sind Netzbetreiber verpflichtet, Erneuerbare-Energien-Anlagen an ihr Netz anzuschließen. Wie fällt hier Ihre Bilanz für E.DIS aus und womit rechnen Sie für die Zukunft?
Wir konnten seit dem Jahr 2000 eine eindrucksvolle Entwicklung vollziehen und damit ein Gelingen der Energiewende mit aller Kraft unterstützen. So haben wir beispielsweise in unserem Netzgebiet das Ziel der Bundesregierung, 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien zu beziehen, bereits vor rund zehn Jahren erreicht. Zwischenzeitlich haben wir eine Grünstromquote von etwa 160 Prozent. Wir produzieren damit also mehr als das Eineinhalbfache des hier tatsächlich benötigten Verbrauchs. Rekordzahlen verzeichnen wir auch bei den PV-Anlagen mit weniger als 30 Kilowatt, wie sie sich insbesondere auf Ein- und Mehrfamilienhäuser befinden. Hier haben wir – nach unserem absoluten Rekordjahr 2023 – auch im vergangenen Jahr mit über 25.000 angeschlossenen Anlagen wieder eine beeindruckende Anzahl an Anlagen ans Netz gebracht.

Die Energiewende muss so effizient wie möglich gestaltet werden, um die Kosten im Griff zu behalten, die letztlich der Verbraucher zahlt, so Dr. Wittenberg. Abbildung: Uwe Tölle für E.DIS AG
Wie werden sich Einspeiseleistung und Verbrauchslast in den nächsten zehn Jahren entwickeln?
Bis 2033 rechnen wir mit einer gesamten Einspeiseleistung in unser Netz von 45 Gigawatt, also 45.000 Megawatt. Das entspricht, bildlich gesprochen, einer Erzeugungsleistung von 45 konventionellen Großkraftwerken. Derzeit sind 16 Gigawatt Leistung installiert – bei einer maximalen Verbrauchslast von 2,5 Gigawatt. Der erhöhte Leistungsbedarf für Elektromobilität und Wärmepumpen sowie weitere Industrie- und Gewerbeansiedlungen, zu denen insbesondere auch neue Rechenzentren zählen, wird zu einem Anstieg der Spitzenlast in unserem Netz führen. Für das Jahr 2033 prognostizieren wir hier eine Spitzenlast von rund 5,5 Gigawatt – also mehr als eine Verdopplung des Status quo. Dabei wird sehr klar, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die beim Hochlauf der Energiewende sehr geholfen haben, nach 25 Jahren einem Effizienzcheck unterzogen werden müssen, um die Entwicklung nachhaltig zu machen. Hier müssen wir insbesondere auch über die Anschlusspflicht für uns als Netzbetreiber in bereits bestehenden Engpassregionen mit viel Abregelung sprechen.
Ostdeutschland wird großes Potenzial bei den erneuerbaren Energien bescheinigt, aber der Netzausbau komme nicht nach, heißt es häufig. Was sagen Sie dazu?
Wir erleben in unserem Netzgebiet eine Anschlussdynamik bei den erneuerbaren Energien, die aufgrund der sehr unterschiedlichen Realisierungszeiten zwangsläufig zu einem nachlaufenden Netzausbau führt. Um dies kurz zu verdeutlichen: Dauert beispielsweise der Bau einer größeren PV-Freiflächenanlage ungefähr zwei Jahre, benötigen wir als Verteilnetzbetreiber für die Planung, Genehmigung und den Bau einer neuen 110.000-Volt-Leitung acht bis zwölf Jahre. Das sind zwei verschiedene Geschwindigkeiten. Hinzu kommt, dass wir seit 2020 fast viermal so viele Anlagen an unser Netz angeschlossen haben wie in den gesamten 20 Jahren zuvor. Insgesamt zählen wir heute bereits fast 200.000 Energiewendeanlagen, von denen PV und Windkraft den weitaus größeren Teil ausmachen. Unsere Investitionen ins Verteilnetz summieren sich seit dem Jahr 2020 auf deutlich über eine Milliarde Euro.
Welche konkreten Vorschläge haben Sie, die vorhandenen Netzkapazitäten noch besser als bisher für die Einspeisung zu nutzen?
Genau darauf weisen wir regelmäßig aktiv und deutlich hin. So ist eine stärkere Synchronisierung zwischen dem weiteren Anschluss von dezentralen Erzeugungsanlagen und unseren vorhandenen Leitungskapazitäten erforderlich. Damit wäre eine regionale Steuerung beim weiteren Zubau von Erzeugungsanlagen gegeben – und Regionen, in denen bereits heute überdurchschnittlich viel Grünstrom erzeugt wird, würden nicht noch stärker mit weiterer Abregelung belastet. Hier brauchen wir dringend eine Korrektur der bisherigen Vorgehensweise. Anderenfalls laufen wir Gefahr, dass die Kosten für die Abregelung von Einspeisemengen, die nicht mehr ins Netz aufgenommen werden können, weiter steigen – was die Energiewende verteuert und ineffizient macht. Am Ende würde eine solche Steuerung an „freie“ Stromleitungen die EE-Strommenge im Netz weiter erhöhen. Selbstverständlich nehmen wir auch die aufwendigen und damit langwierigen Genehmigungsverfahren für den Hochspannungsbau nicht einfach so hin, sondern machen ebenfalls regelmäßig darauf aufmerksam, dass insbesondere für ein „Repowering“ – die Verstärkung bestehender Hochspannungsleitungen in bereits bestehenden Trassen – deutliche Vereinfachungen erforderlich sind.

Dr. Patrick Wittenberg hat einen Beitrag zum zweiten Band von „Denke ich an Ostdeutschland …“ beigesteuert. Dieser erscheint im September 2025. Abbildung: ostdeutschland.info
Bislang waren sogenannte Brownouts – kontrollierte Stromreduzierungen – in der Diskussion, um bei Dunkelflauten das Netz stabil zu halten. Neu ist die Warnung vor Hellbrisen. Wie sicher ist die Versorgungssicherheit in Deutschland?
Deutschland verfügt über eine der zuverlässigsten Stromversorgungen weltweit. Um die Begriffe kurz zu erklären: Bei einer Dunkelflaute – zu wenig Erzeugung und zu viel Verbrauch – und bei einer Hellbrise – zu viel Erzeugung und zu wenig Verbrauch – handelt es sich um unterschiedliche Szenarien, die wiederum unterschiedliche Maßnahmen erfordern, damit das Netz in Balance gehalten werden kann. Bei einer Hellbrise kann die Abregelung von beispielsweise großen PV-Anlagen oder Windkraftwerken als Schutzmechanismus dienen, mit dem das Stromnetz in Balance gehalten werden kann.
Deutschland verfügt über eine der zuverlässigsten Stromversorgungen weltweit.“
Auf der iberischen Halbinsel gab es im Frühjahr einen Blackout. Wird ausreichend in die Netzstabilisierung investiert, damit so etwas auch künftig nicht in Deutschland vorkommen kann?
Ein großflächiger langanhaltender Stromausfall, wie er sich Ende April in Spanien und Portugal ereignet hat, ist nach derzeitigem Kenntnisstand unwahrscheinlich. Ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zur iberischen Halbinsel liegt darin, dass Deutschland aufgrund seiner geografischen Lage in der Mitte Europas besser in das europäische Verbundnetz eingebettet ist. Dieses hat auch eine stabilisierende Wirkung. Und natürlich leisten auch wir unseren regionalen Beitrag, um eine zuverlässige Versorgung unserer Kunden sicherzustellen: Wir inspizieren unsere Anlagen regelmäßig und überwachen ihre Funktionen. Außerdem forcieren wir die Digitalisierung in unseren Spannungsebenen, was uns ebenfalls dabei hilft, Störungen zeitnah zu erkennen und zügig zu beheben. Die Investitionen in unsere Netzinfrastruktur liegen bei derzeit rund 300 Millionen Euro im Jahr, mit steigender Tendenz. Selbstverständlich trägt die umfangreiche Modernisierung unseres Verteilnetzes auch zur Erhöhung der Versorgungssicherheit bei.
Vielen Dank für das Gespräch.
Die Fragen stellten Christian Marx und Dr. Robert Nehring.